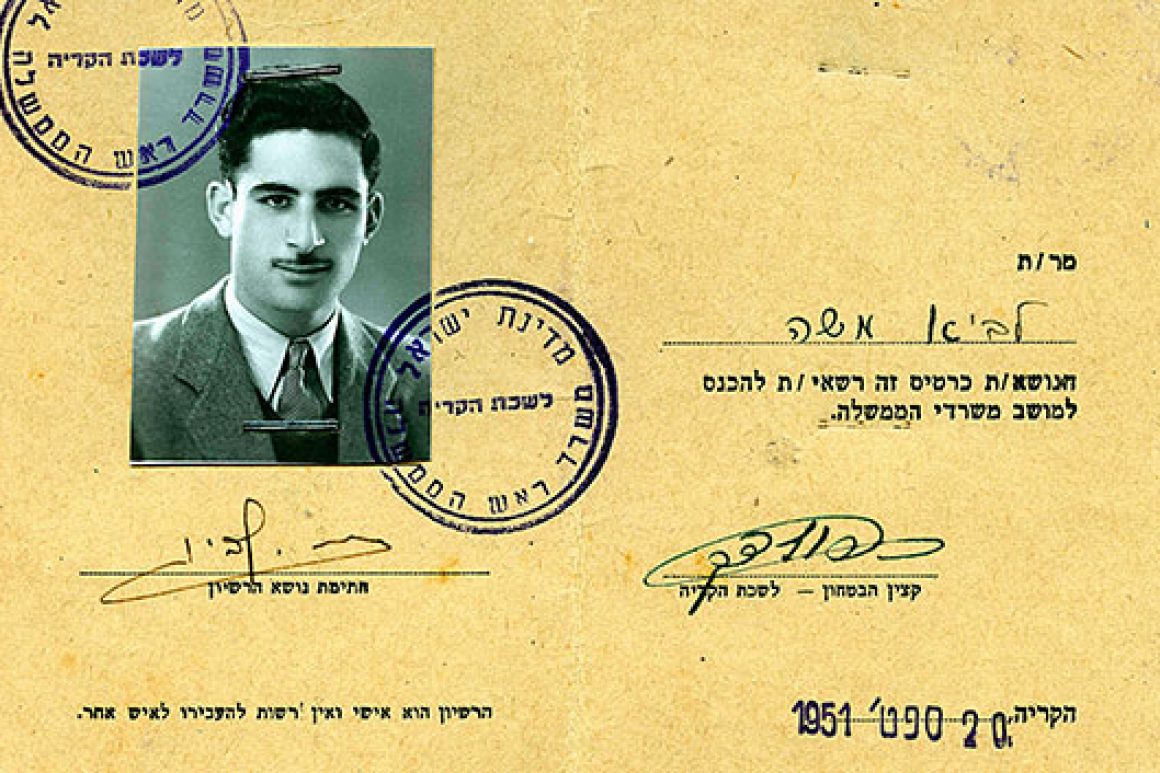Der amerikanische Regisseur Steven Spielberg bemüht sich seit Jahren, mit seiner »Shoah Foundation« die Erinnerungen von Holocaust-Überlebenden aufzuzeichnen und für die Nachwelt zu bewahren. Die meisten der Interviewten sind europäische, also aschkenasische Juden. Jetzt will ein Wissenschaftler das Gleiche für sefardische Juden tun – solche mit Wurzeln im Nahen Osten und Nordafrika.
Der Mann hinter dem Projekt mit dem Namen »Sephardi Voices« (»Sefardische Stimmen«) ist Kanadier und hat selbst europäische Wurzeln. Henry Green, Historiker und Soziologe an der Universität von Miami, hat Zeugnisse der Juden aus dem Irak, aus Ägypten, Marokko, Syrien, dem Libanon, Libyen, Tunesien und Algerien gesammelt.
Green, der aus einer religiösen Familie in Ottawa stammt, sagt, er habe sich entschlossen, die Geschichten von sefardischen Juden zu sammeln, weil sie bisher sehr viel schlechter dokumentiert seien als die der aschkenasischen Juden. »Wenn ich sie jetzt nicht dokumentiere, wird es bald zu spät sein«, sagte Green kürzlich während einer Reise nach Israel.
Verfolgungen Green startete sein Projekt im Jahr 2009. Seitdem hat er rund 300 Interviews mit Sefardim gefilmt, die nach Großbritannien, Kanada, Frankreich, in die USA und nach Israel eingewandert sind. Sie erzählten ihm sowohl von dem Wohlstand, in dem viele von ihnen in arabischen Ländern lebten, als auch von Verfolgung und Vertreibung.
Vor der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 lebte etwa eine Million Juden in arabischen Ländern, die meisten der dortigen Gemeinden existierten bereits seit Jahrhunderten. Nach 1948 jedoch verschlechterte sich deren Situation dramatisch, die Verfolgungen nahmen zu, die meisten Juden waren gezwungen, aus ihren Heimatländern zu fliehen und ihr Eigentum zurückzulassen. Viele von ihnen zogen nach Europa und Nordamerika, die meisten aber kamen nach Israel. Green schätzt, dass etwa 70 Prozent derjenigen, die damals ihre Heimat verlassen mussten, heute nicht mehr am Leben sind.
In den Interviews mit Green und seinen Mitarbeitern beschreiben die Menschen Pogrome und andere Grausamkeiten, die auch schon vor der israelischen Staatsgründung stattgefunden hatten: So wurden etwa im Juni 1941 rund 150 irakische Juden ermordet, 130 libysche Juden in Tripoli im Jahr 1945 sowie Dutzende von Juden in Ägypten im Jahr 1948.
Diskriminierung In den 70er-Jahren hatte Green an der Hebräischen Universität in Jerusalem studiert. Dort erfuhr er zum ersten Mal von den Schwierigkeiten der sefardischen Juden im Israel der Gegenwart. Er bekam mit, wie sie sich gegen Diskriminierungen vonseiten des aschkenasischen Establishments wehrten.
Mit seinen »Sephardi Voices« hat Green sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: In den kommenden Jahren soll das Archiv gefilmte Interviews mit rund 5000 Menschen enthalten. Die einzelnen Interviews werden in den verschiedenen Ländern von einheimischen Mitarbeitern durchgeführt.
Die »Sephardi Voices« stehen in einer Reihe mit anderen internationalen Projekten der vergangenen zwei Jahrzehnte, die das Leben von Zeugen jüdischer Geschichte dokumentieren. In Israel etwa gibt es zwei Initiativen, die die Erfahrungen von Veteranen des Unabhängigkeitskrieges dokumentieren. Schoa-Überlebende erzählten ihre Geschichten der Gedenkstätte Yad Vashem und Spielbergs »Survivors of the Shoah Visual History Foundation«. Zehntausende Menschen wurden für diese Projekte interviewt, die meisten davon Aschkenasim.
Kapitel »Doch keines dieser Projekte hat sich bisher mit den Erfahrungen der Juden aus Nordafrika, dem Nahen Osten und dem Iran beschäftigt, die aus ihren Häusern und Wohnungen vertrieben wurden«, heißt es auf der Website der »Sephardi Voices«. »Indem wir die Geschichten der sefardischen Juden (Mizrachim) aufzeichnen, geben wir die Erinnerungen von Menschen, die in Gemeinden aufgewachsen sind, die häufig nicht mehr existieren, an die nächsten Generationen weiter und schaffen damit ein Gefühl von Stolz und Kontinuität.«
Und Henry Green betont, er wolle mit seinen sefardischen Stimmen die Geschichte des Zionismus und die jüdische Identität um ein Kapitel erweitern, mit dem viele nicht vertraut sind.
Green verhandelt derzeit mit der Israelischen Nationalbibliothek darüber, wie man die Ergebnisse seiner Arbeit am besten der Öffentlichkeit zugänglich machen kann. In der Zwischenzeit können die Zeugnisse in der British Library in London eingesehen werden. Im Internet sind sie noch nicht verfügbar.
Nur vergleichsweise wenige Israelis sind bisher für das Projekt interviewt worden. Um das zu ändern, wollen die »Sephardi Voices« in Israel nun auch mit dem Institut für zeitgenössisches Judentum, der Abteilung für Oral History der Hebräischen Universität Jerusalem und dem Babylonian Jewry Heritage Center zusammenarbeiten.
www.sephardivoices.org.uk
www.jimena.org/oral-history-program