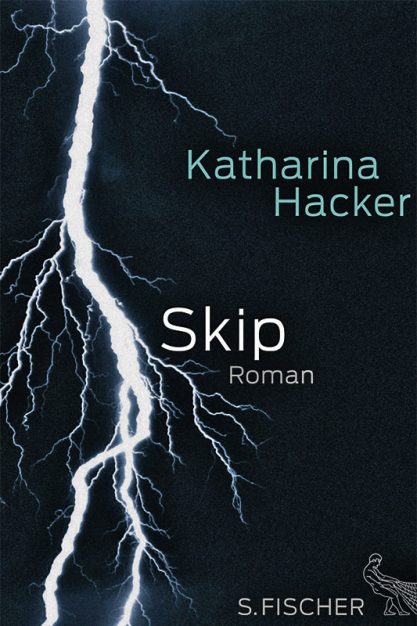Jonathan Landau, von allen nur Skip genannt, restauriert in Israel alte, unbewohnbar gewordene Häuser. An größere Aufträge kommt er als Architekt nicht heran. Seine Mutter war keine Jüdin, aber sein jüdischer Vater hatte in Paris für seine Brit Mila gesorgt.
In Tel Aviv ist er mit Shira verheiratet, die mit ihm keine Kinder bekommen kann. Die beiden Söhne lässt sie sich von einem anderen Mann zeugen: Naim und Avi. Skip, weder »richtiger« Architekt, noch »richtiger« Jude oder »ganzer« Mann, ist der Protagonist des gleichnamigen Romans von Katharina Hacker.
Die Schriftstellerin und Trägerin des Deutschen Buchpreises ist vor 48 Jahren in Frankfurt geboren worden und hat mit ihren Studien der Philosophie, Geschichte und Judaistik in Jerusalem das Rüstzeug für dieses Buch erworben. Skip erzählt in der ersten Person, nur selten kommt eine Stimme aus dem allwissenden Off hinzu. Er spricht meist zu sich selbst, in inneren Monologen, Träumen, Phantasien.
Nur manchmal bricht er – scheinbar unmotiviert – auf, lässt seine Frau in Tel Aviv zurück, fliegt nach Paris oder nach Amsterdam, wird hier Zeitzeuge eines schweren Zugunglücks, dort eines Flugzeugabsturzes, und zwängt sich in eine moralische Verantwortung für die Opfer.
Intifada Derweil wächst in Israel – der Roman spielt kurz vor der zweiten Intifada – die Gewalt zwischen Juden und Palästinensern. »Das Leid häufte sich an, ohne Rücksicht darauf, dass Menschen glaubten, irgendwann müsse es genug sein.« Die Autorin lässt Skip und sein Umfeld für Frieden und Toleranz einstehen, Gewalt ist für keinen akzeptabel. Dieser politisch-moralische Grundton beherrscht den Roman. Shira erkrankt und wird von einem palästinensischen Arzt mit illegal besorgtem Morphium versorgt.
Der muss dafür ins Gefängnis, und Skips Frau stirbt. Mit großer Ehrlichkeit reflektiert Skip die schwindende Liebe zwischen ihm und seiner Frau. Nach ihrem Tod machen die beiden Söhne Abitur, leisten ihren Wehrdienst und gehen dann zum Studium nach England. Skip findet eine Anstellung in einem florierenden Architekturbüro, bekommt lukrativere Aufträge und lernt Zipora kennen, eine viel jüngere Frau, die im gleichen Büro arbeitet.
Dort ergeben sich für ihn nach der Wende Aufträge in Berlin, also ausgerechnet dort, wo die Ermordung seiner Großeltern angeordnet worden war – für ihn anfangs ein Schock. Im letzten Viertel des Romans wechselt der Schauplatz in die deutsche Hauptstadt, wo die Autorin lebt, sich bestens auskennt und den so oft traurigen Roman zu einem glücklichen Ende bringt, weil Skips beide Söhne nach Berlin ziehen und weil Skip etwa zur gleichen Zeit Großvater und Vater werden wird.
Gedanken Katharina Hacker gelingt das Wunder, in ihrem Roman nicht nur eine vielfältige und abwechslungsreiche Handlung unterzubringen, die in ständigem Fluss bleibt. Überwältigend sind die Gedanken, die sich Skip über seine spezielle und die allgemein gültige condition humaine macht. »Freiheit ist vielleicht, die Zeit in ihrem inneren Zusammenhalt zu begreifen, der nicht Ablauf ist sondern Struktur, Gewissheit, eine Art zu denken.«
In diesem großartigen Roman stehen die menschliche Existenz, Leben und Tod, Liebe und Abstammung, Zärtlichkeit und Hass in einer philosophischen Prüfung.
Die Autorin findet für diese Vielfalt an Handlung und Gedanken perfekte Worte und Sätze, ohne ihren Roman mit dieser wunderbaren Fracht zu überladen – und lässt den Leser in der oft traurigen Grundstimmung zum Glück nicht ohne Hoffnung zurück.
Katharina Hacker: »Skip«. S. Fischer, Frankfurt am Main 2015, 384 S., 21,99 €