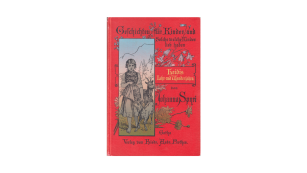Herr Dratwa, Sie sind hoher Beamter bei der Europäischen Kommission und gleichzeitig Universitätsprofessor für Philosophie in Brüssel. Wie arbeiten Sie seit Beginn der Corona-Krise? Aus dem Homeoffice?
Ja, das Arbeiten von zu Hause aus ist auch hier mittlerweile der Normalfall geworden – zumindest für all jene, die noch einen Job haben und ihn auch zu Hause ausüben können. Diese Pandemie bedeutet, dass wir beruflich und auch sonst mit neuen Formen experimentieren müssen, nicht nur, was das Zusammenleben angeht, sondern auch das »gemeinsame Schaffen«.
Was gibt Ihnen derzeit persönlich Kraft und Inspiration?
Der Pessach-Seder war dieses Jahr etwas Besonderes. Nah und fern, offline oder online, über die Generationen hinweg haben wir noch eindringlicher als sonst gespürt, dass da etwas ist, was uns verbindet: ein Gefühl des Miteinander. Lasst uns längere Tische bauen, nicht höhere Mauern! Die ewigen Fragen, die Pessach bei uns aufwirft: nachzudenken, was wirklich wichtig ist, was den Unterschied ausmacht (»Ma Nischtana«), und auch zu erfragen, wie wir in der heutigen Zeit die Freiheit für alle fördern können. Jetzt kommen die inspirierenden Fragen von Schawuot mit perfektem Timing: Was haben wir geerntet? Was schulden wir einander? Forderungen nach Solidarität und Fürsorge.
Stichwort Fürsorge: Wie steht es darum in Zeiten von Corona?
Diese Pandemie ist wie ein zerbrochener Spiegel. Darin erkennen wir sowohl die Stärken unserer modernen Gesellschaften als auch ihre Schwächen. Wir sehen Ängste, aber auch Aspirationen. Es gibt auf der einen Seite gesellschaftliche Ungerechtigkeit, autoritäre Machtstrukturen und soziale Ungleichheiten. Auf der anderen Seite sind da aber auch Widerstandsfähigkeit und Solidarität. In dieser Krise braucht es kollektives Handeln. Nicht jeder ist ja gleichermaßen betroffen. Einige haben Zugang zu guter Gesundheitsversorgung, andere nicht. Einige können die Ausgangssperre in komfortablen Häusern verbringen, andere leben auf engstem Raum, manche sogar in Slums und Flüchtlingslagern. Wir müssen Antworten geben auf diese Ungleichheiten in der Gesellschaft und auf die emotionalen Härten, die das verursacht – auch in der Zeit nach der Pandemie.
Was heißt das konkret?
Das heißt, die negativen Effekte zu bedenken, die die Beschränkungen auslösen, zum Beispiel in Bezug auf häusliche Gewalt, aber auch auf die Konzentration wirtschaftlicher Macht. Das gilt natürlich auch im Positivem. Wir erkennen jetzt besser, wie in unseren Gesellschaften Dinge wie Gesundheitsversorgung, Altenpflege oder auch Kinderbetreuung fast schon unsichtbar gemacht und an den Rand geschoben waren. Nun stehen sie plötzlich im Mittelpunkt.
Die Corona-Krise hat auch die Europäische Union schwer gebeutelt. Grenzen wurden geschlossen, ein Miteinander der 27 Mitgliedsländer war nicht immer erkennbar …
»Europa« ist ja schon vom Grundgedanken her ein auf Solidarität ausgerichtetes Projekt; es steht und fällt damit. Es ist richtig: Am Anfang der Epidemie hat es einen Fehlstart gegeben. Aber das ist vorbei, Europa steht jetzt wieder zusammen. Und mit jedem Akt der Solidarität wird es wieder ein kleines bisschen stärker. Diese Epidemie ist auch eine Epidemie der Diskonnektion, der Entfremdung. Sie ist für das Zusammenleben in Europa, für die gegenseitige Solidarität, eine große Herausforderung. Ich denke aber, dass, je länger sie anhält, desto mehr sichtbar wird, dass nationale, isolierte Herangehensweisen fragwürdig und wenig erfolgversprechend sind. Darüber hinaus sollten wir auch einmal anerkennen und feiern, dass es in den letzten Wochen zahlreiche Formen der gegenseitigen Hilfe zwischen Einzelnen, Gruppen und Ländern gegeben hat.
Es wird ja auch in Deutschland gerade heftig darüber diskutiert, ob dem Schutz des Lebens unbedingter Vorrang einzuräumen ist, auch wenn das eine Verletzung anderer Grundrechte bedeutet. Was sagen Sie als Ethiker dazu?
Das ist ein spannendes Thema. Dass Grundrechte und sogenannte »höhere Schutzgüter« wie die Volksgesundheit in einem gewissen Spannungsverhältnis zueinander stehen, ist ja nicht neu. Ich halte aber nichts von einem Framing, in dem das eine gegen das andere ausgespielt wird. Wer so etwas tut, ignoriert im besten Fall die Risiken und liefert womöglich sogar Argumente für jene, die autokratische Mechanismen einführen wollen.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Es gibt gerade eine Debatte um den Einsatz technologischer Mittel, wie zum Beispiel das Bewegungstracking in Handys oder die Überwachung von Menschen durch Drohnen. Wir wissen, wie schwer es ist, technische Innovationen, wenn sie einmal eingeführt sind, wieder zurückzudrängen. Das gilt auch für politische Maßnahmen, die Freiheitsrechte, demokratische Teilhabe und die Rechtsstaatlichkeit einschränken – man wird sie nur schwer wieder los. Die größte Gefahr aber sehe ich darin, dass es nach dem Ende des »Ausnahmezustands« als normal angesehen wird, dass gewisse Freiheiten nicht mehr da sind. Akute Wachsamkeit ist angesagt.
Was würden Sie raten, gerade im Hinblick auf neue Technologien?
Forschung und Innovation, Wissenschaft und Technologie können tatsächlich helfen – vorausgesetzt, dass die Öffentlichkeit in die Entwicklung neuer Anwendungen einbezogen wird und dass unsere Grundwerte nicht als Stolperstein, sondern als moralischer Kompass angesehen werden. In welcher Welt wollen wir gemeinsam leben? Welche Grundwerte entwickeln wir in unsere Innovation hinein? Die Corona-Pandemie hat schon viele Beispiele für technologische Neuerungen gebracht, in der Werte wie Solidarität, Verantwortung und Zusammenhalt im Mittelpunkt stehen: Tauchmasken zum Beispiel, die zu Open-Source-Beatmungsgeräten umgebaut wurden. Die Annahme, wir könnten durch Technologie und andere Mittel alles kontrollieren oder vorausplanen, hat sich aber als falsch erwiesen. Wir sind alle verletzlich, wir sind alle auf andere angewiesen.
Was können wir aus der Krise lernen?
Wir können eine Epidemie der anderen Art auslösen: eine der Fürsorge, der Teilhabe und der Solidarität. Es ist Zeit für neues Denken, sowohl individuell als auch kollektiv, um die Prioritäten der Zukunft festzulegen. Diese weltweite »Unterbrechung« unseres normalen Lebens könnte auch ein struktureller Bruch sein, um neuem Denken zum Durchbruch zu verhelfen.
Was meinen Sie mit »neuem Denken«?
Wir dürfen nicht in die alten Muster zurückfallen, sondern müssen die Krise als Aufforderung für Veränderung begreifen. Wir sollten nicht in ›business as usual‹ zurückfallen. Ich würde mir wünschen, dass wir uns bald austauschen und darüber verständigen, welches die Grundlagen unserer freiheitlichen Gesellschaften sind, welche ökologischen, ökonomischen und politischen Modelle dafür notwendig sind und – ganz konkret – wie Wohlstand und Ressourcen gerechter verteilt werden sollten.
Ist das nicht illusorisch?
Wenn es vorher Zweifel gab, dann ist nach diesen letzten Wochen der Covid-19-Krise nun für alle sichtbar: Eine andere Welt ist möglich! So habe ich mir das jüdische Prinzip Tikkun Olam immer vorgestellt: Die Welt nicht nur zu reparieren und so wiederherzustellen, wie sie vorher war, sondern sie zu verändern. Natürlich sind die Kräfte des »Zurück zur Normalität« stark – und das, obwohl mittlerweile immer mehr Menschen erkennen, wie unnormal diese Normalität war. Es werden derzeit in Europa und weltweit wichtige Haushaltsentscheidungen getroffen. Von Investitionsorientierungen bis hin zu Schulden werden diese die Welt für zukünftige Generationen prägen. Das Fenster der Möglichkeiten schließt sich schnell wieder, aber ich hoffe, dass die Samen der Veränderung gepflanzt sind.
Wer ist Ihrer Meinung nach der Ethiker, auf dessen Rat man in diesen Zeiten hören sollte?
Ich könnte Ihnen jetzt eine Reihe von Autoren nennen, deren Bücher auf meinem Schreibtisch stehen und die mich beeindruckt haben. Menschen wie Baruch Spinoza, Emmanuel Levinas, Hannah Arendt, Gilles Deleuze, Isabelle Stengers, Bruno Latour, Sheila Jasanoff und Sarah Jane Pugh. Aber ich nennen Ihnen einen anderen Namen: Ihren. Ethik ist ja ein Aufruf zur Reflexivität, zum Nachdenken und Sich-Selbst-Befragen. Der Ethiker, an den Sie sich in diesen Zeiten mehr denn je im Geiste des Dialogs wenden können, sind Sie selbst.
Mit dem Professor für Philosophie an der Freien Universität Brüssel sprach Michael Thaidigsmann.
2013 wurde Jim Dratwa vom damaligen Präsidenten der Europäischen Kommission als Berater für Ethikfragen, Wissenschaft und Technologie eingestellt. Zuvor studierte der heute 40-jährige Belgier auf beiden Seiten des Atlantiks Physik, Philosophie, Politik- und Umweltwissenschaften und lehrte unter anderem an den Universitäten Sciences Po in Paris und Harvard. Unter der der Obama-Regierung wurde er zum ersten Global Fellow des Woodrow Wilson Center ernannt. Heute leitet er bei der Europäischen Kommission ein Team von Politikberatern, das sich mit Ethikfragen in Wissenschaft und neuen Technologien auseinandersetzt. Daneben ist Dratwa Philosophieprofessor an der Freien Universität Brüssel. Sein Spezialgebiet ist die Verbindung von Wissen, Werten und politischem Handeln. Ehrenamtlich engagiert sich Dratwa auch im interkulturellen und interreligiösen Dialog.