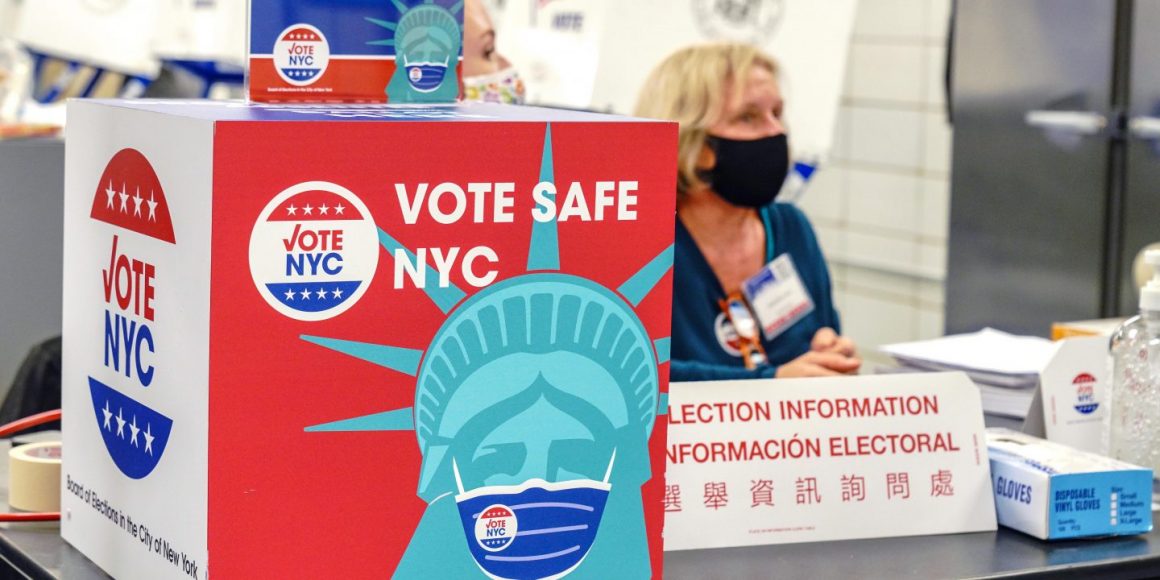Eine Wahlnacht, die kein eindeutiges Ergebnis bringt – das war nicht nur das Horrorszenario für die Demokraten, die auf eine schnelle Entscheidung gehofft hatten, das schürt auch die Sorgen, wie es jetzt weitergeht in den USA.
In einer Erklärung des Secure Community Network (SCN) – offizieller Sicherheitsarm der »Jewish Federations of North America« (JNFA) und der »Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations« (CoP) – heißt es: »Derzeit gibt es keine uns bekannten, ernst zu nehmenden Drohungen gegen jüdische Institutionen oder Organisationen … in Zusammenhang mit der Wahl von 2020. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass die jüdische Gemeinschaft von Reaktionen auf das Ergebnis der US-Wahlen betroffen sein könnte. Weiterhin begleiten erhitzte Emotionen die Wahl, die für eine erhöhte Bedrohungslage bis mindestens Anfang 2021 sorgen könnten.«
bedrohungen Weiter heißt es in der Erklärung, aus der der »Algemeiner« zitiert: »Es ist weiterhin wahrscheinlich, dass gewalttätige Extremisten Individuen oder Institutionen ins Visier nehmen könnten, die Symbole für ihren Unmut oder Ausdruck von Ablehnung aufgrund politischer Vorlieben sind. Das erhöht das Risiko politischer oder ideologischer Bedrohungen der jüdischen Gemeinschaft.«
Eine Aussage, die in ihrer Einzigartigkeit recht treffend wiedergibt, wie besonders diese Präsidentenwahl ist – für das Land insgesamt, aber auch für die Juden im Besonderen.
VERZÖGERUNG Donald Trump könnte die Verlängerung des Wahltags zu einer möglichen Wahlwoche in die Karten spielen, hatte er doch immer auf die Briefwahlen geschimpft und sie zur Quelle von Betrug erklärt. Es gilt weiterhin als unsicher, ob der Präsident eine verspätete Auszählung ohne Weiteres akzeptieren würde.
Donald Trump könnte die Verlängerung des Wahltags zu einer möglichen Wahlwoche in die Karten spielen.
Die Verzögerung des Wahlabends hat mehrere Ursachen. Zum einen die exorbitant hohe Wahlbeteiligung. Rund 101,9 Millionen Amerikaner hatten bereits gewählt, bevor am 3. November die Wahllokale überhaupt öffneten. Das waren bereits 73 Prozent aller Wähler, die 2016 abgestimmt hatten. Zum Vergleich: 2016 lag der Anteil der Brief- und Frühwähler bei 47 Millionen. Diese Zahl wurde also 2020 – auch aufgrund der Corona-Pandemie – mehr als verdoppelt.
In den sogenannten Battleground States, den Staaten, die heftig umkämpft sind, wählten gut 44,7 Millionen Menschen vorab. Eine Faustregel besagt, dass Briefwähler eher demokratisch wählen und Republikaner lieber persönlich an die Urne gehen – ob am Wahltag oder früher. Das war auch einer der Hauptgründe, warum US-Präsident Trump seine Kampagne gegen die Briefwahl startete.
BRIEFWAHL Das Problem mit der Briefwahl: Es gibt in den USA keine einheitliche Regelung, was die Briefwahl anbelangt – geschweige denn deren Auszählung. Manche Staaten zählen die Frühstimmen als erste (wie Florida), andere erst später, manche erst Tage nach dem eigentlichen Wahltermin.
Ein höchstrichterlicher Beschluss kurz vor den Wahlen verdonnerte die Wahlämter in einigen Bundesstaaten dazu, alle Stimmen zu zählen, die bis einschließlich 9. November postalisch zugestellt werden, teilweise sogar bis zum 12. November. Das wäre im Extremfall neun Tage nach dem Wahldienstag.
Im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania reichte Trumps Team bereits Klage ein.
Die gewaltige Anzahl der Brief- und Frühwahlstimmen kann bei knappen Zwischenständen scheinbar feststehende Ergebnisse problemlos auf den Kopf stellen, wie sich etwa in Virginia zeigte. Dort führte Trump mit großem Vorsprung, ehe Biden binnen weniger Minuten nach Auszählung der Frühstimmen mit 6,5 Prozent Vorsprung Virginias 13 Wahlmännerstimmen auf der Habenseite verbuchen konnte.
VORBEHALTE Wenn man davon ausgeht, dass nach einer Umfrage, die der »Jewish Telegraphic Agency« (JTA) vorliegt, 70 Prozent der amerikanischen Juden für den ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden stimmen wollten und nur 27 Prozent für Donald Trump, die Briefwahl grundsätzlich von Demokraten bevorzugt wird, werden die Vorbehalte Trumps gegen die Briefwahl nachvollziehbarer, wenn auch nicht verständlicher unter demokratischen Gesichtspunkten.
Gänzlich unverständlich allerdings waren die Vorwürfe Trumps, die er am frühen Morgen in Deutschland – zunächst bei Twitter – äußerte. Nachdem er sich bis nach Mitternacht in den USA zurückgehalten hatte, legte er los und sprach von »Wahlbetrug«. Twitter blockierte die Behauptung kurze Zeit später. Doch die Trump-Kampagne glaubt offensichtlich ihre eigene Mär vom »potenziellen Wahlbetrug«.
Die Trump-Kampagne glaubt offensichtlich ihre eigene Mär vom »potenziellen Wahlbetrug«.
Auch auf Trumps »spätester Pressekonferenz, die ich je hatte«, um 2.20 Uhr Ortszeit, kurz vor halb 9 Uhr in Deutschland am Mittwochmorgen, änderte sich nichts daran. »Wir hatten alles gewonnen und haben uns auf eine tolle Feier gefreut – und plötzlich wurde alles abgesagt. So ein Erfolg, so ein Ergebnis. Aber sie zeigen die Ergebnisse nicht«, sagte Trump, der sich unfassbarerweise in praktisch allen derzeit noch umkämpften Staaten zum Sieger erklärte.
betrug »Was ist mit der Wahl passiert? Sie wussten, sie könnten nicht gewinnen – und nun ziehen sie vor Gericht. Das ist Betrug am amerikanischen Volk. Wir haben diese Wahl gewonnen. Wir werden vor das Oberste Gericht gehen und alle Auszählungen stoppen, damit nicht morgens um vier plötzlich noch irgendwelche Stimmen gefunden werden.«
Vor Gericht zog bisher einzig Trumps Team. In dem umkämpften US-Staat Pennsylvania wurde bereits Klage gegen angeblich unsachgemäß aussortierte Stimmzettel eingereicht. Naturgemäß rüsten sich auch die Demokraten für eventuelle juristische Auseinandersetzungen. So manches Endergebnis könnte deshalb wirklich vor Gericht erstritten werden. Und das könnte auch die jüdischen Sorgen vor politischen Übergriffen und Attacken während einer politischen Hängepartie weiter anheizen.