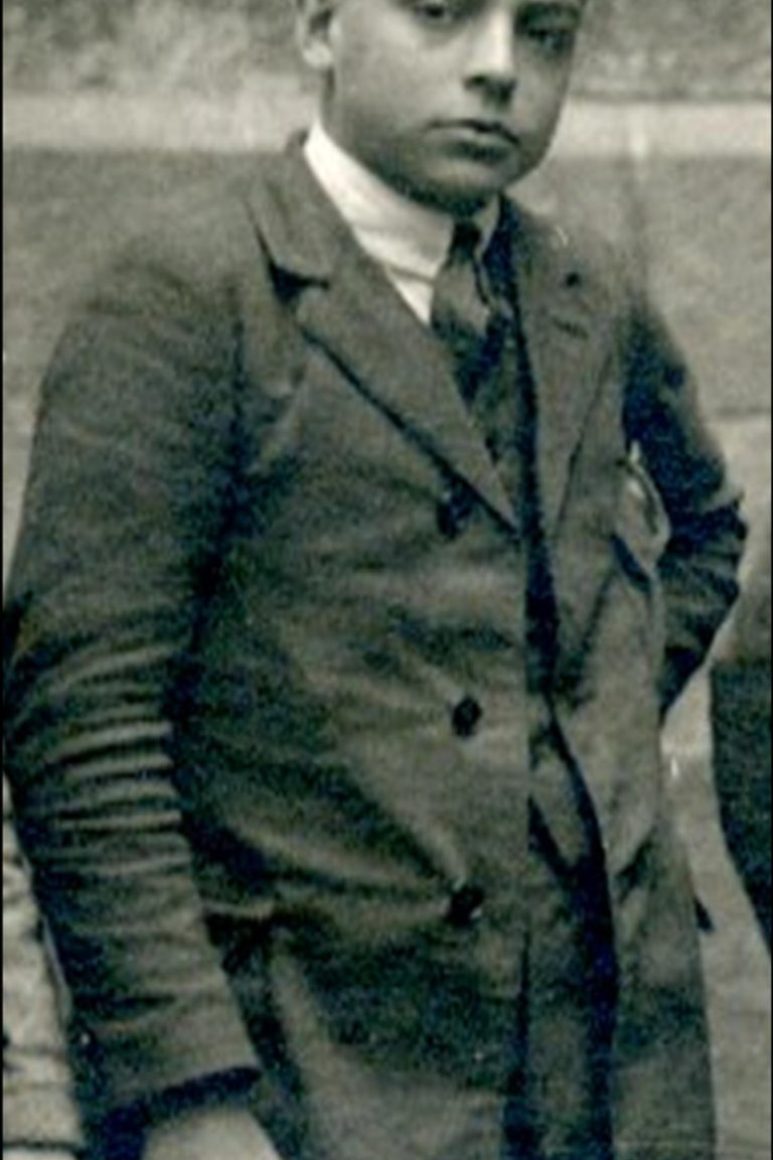Am 17. Oktober 1935 geht ein Schreiben in der Abteilung drei beim Amtsgericht Erfurt ein. Betreff: »3 gen. IX«. Abschicken musste es Alex Heilbrun, promovierter Jurist und Notar. Die Zeilen, die aus den Buchstaben der Schreibmaschine auf das Papier gelangten, drücken das erzwungene Ende eines Berufslebens aus.
»Unter Bezugnhame auf das Schreiben vom 10.10.35 überreiche ich anbei: 1) meinen Notar-Amtstempel, 2) mein Notar-Siegel (Petschaft), 3) mein Notar-Siegel (Oberprägestück aus der Siegelmaschine). Ich bitte, die Siegel und Stempel vorläufig nicht (…) unbrauchbar zu machen.« Zwölf Tage später ist vermerkt: »Siegel, Stempel, Register und Akten sind in Verwahrung genommen.« Die abgelieferten Siegel und Stempel seien »durch Zerschlagen unbrauchbar gemacht worden«. Ein Berufsleben zerschlagen, ein Menschenleben zerstört. Bereits im April 1933 erhielt Alex Heilbrun Hausverbot für das Gerichtsgebäude in Erfurt. Am 30. November 1938 wurde ihm die Rechtsanwaltszulassung entzogen. Er wurde ins KZ Buchenwald verschleppt und 1942 ins Ghetto Belzyce deportiert. An sein Schicksal und das vieler anderer Juristen erinnert seit Dienstagnachmittag die Ausstellung »Ich war hier… Eine Spurensuche nach jüdischen Kollegen und Kolleginnen in der Thüringer Justiz nach 1933« am Thüringer Oberlandesgericht Jena.
Zwei Monate werden die Biografien der Juristen zu sehen sein.
Die Grundidee dazu: Auf drei digitalen Bildschirmsäulen, im Eingangsbereich des Gerichts aufgestellt, werden Leben und Wirken von jüdischen Kollegen aus der Thüringer Justiz vorgestellt. Über die Touchdisplays können Inhalte navigiert werden. »Es geht darum, jüdische Kollegen und Kolleginnen sichtbar zu machen, dem Vergessen die Erinnerung entgegenzusetzen. Und dies an den Orten, an denen die jüdischen Juristen wirkten. Es ist ein Auftakt für eine Spurensuche, an der sich sowohl die Justiz als auch interessierte Menschen aus der Bevölkerung beteiligen können«, heißt es in der Beschreibung zur Ausstellung.
Zwei Monate werden die Biografien der Juristen zu sehen sein. Darunter auch die von Theodor Emanuel Gutmann, Gerichtsreferendar in Gotha. Der gebürtige Gothaer studierte in München, Cambridge, Berlin und Jena, wo er 1933 promoviert wurde. Die Nationalsozialisten entließen ihn aus dem Vorbereitungsdienst, weil er Jude war. Ihm gelang die Emigration nach Spanien und 1936 die Auswanderung in die USA, wo er bis zu seinem Tod 1997 in Walnut Creek lebte. Gutmann, Heilbrun und so viele andere Kollegen prägten das Gerichtsleben. Geehrt werden sie durch die Ausstellung, deren nächster Stopp Weimar ist.