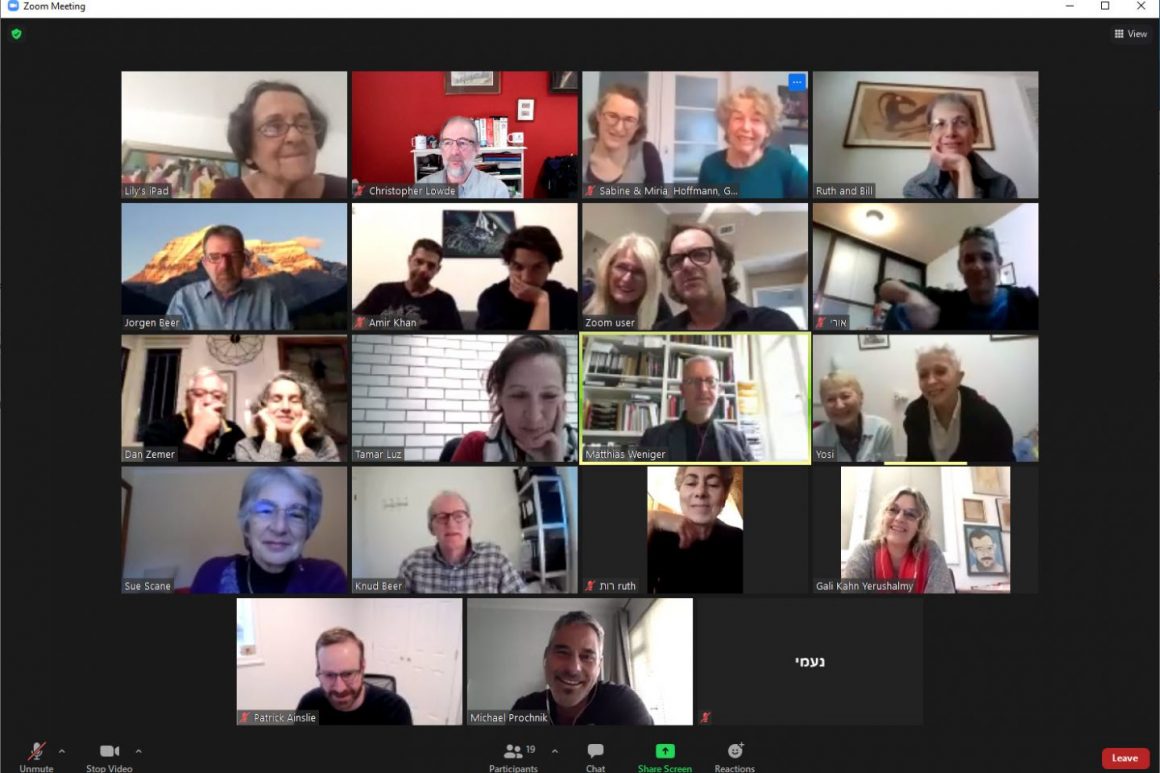Silberabgabe – hinter diesem fast unverfänglich klingenden Begriff aus dem Wortschatz des nationalsozialistischen Verwaltungs- und Machtapparats verbirgt sich eines jener dunklen Kapitel, die zum Räderwerk des Holocaust gehörten. Der groß angelegte systematische Raub von Eigentum jüdischer Familien war neben der Entrechtung, Verfolgung und Ermordung von Juden eine tragende Säule des nationalsozialistischen Regimes. Die Aufarbeitung ist auch Jahrzehnte später nicht abgeschlossen.
Das Bayerische Nationalmuseum, das sich in die Liste der Profiteure der sogenannten Silberabgabe einreiht, ist bei der Vergangenheitsbewältigung auf der Zielgeraden angekommen. Matthias Weniger ist Leiter der Provenienzforschung des Museums und hat sich in den vergangenen zwei Jahren intensiv mit der Materie beschäftigt. Jetzt kann er sich über die Fortschritte freuen. »Inzwischen habe ich mit 40 der 64 betroffenen Familien Kontakt, und rund ein Drittel der Fälle mit fast der Hälfte der Objekte nähert sich dem Abschluss«, lautet seine Bilanz.
erinnerungskultur Welche Bedeutung solche Gegenstände in der Erinnerungskultur der Juden und insbesondere einzelner Familien haben, wurde am »Tag der Provenienzforschung« am 14. April in einer gemeinsamen digitalen Veranstaltung des Instituts für Kunstgeschichte der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) und des Bayerischen Nationalmuseums deutlich. An dem zweistündigen Zoom-Gespräch, das von Matthias Weniger moderiert wurde und inzwischen auch auf der Webseite des Nationalmuseums abgerufen werden kann, nahmen auch mehrere Mitglieder betroffener Familien teil. Sie symbolisieren beispielhaft, welch unermessliches Leid und welche Schicksale sich hinter diesem dunklen Kapitel deutscher Geschichte verbergen.
Zu den Teilnehmern der virtuellen Gesprächsrunde gehörten Angehörige der Familie Neumeyer wie etwa Peter Neumeyer, der Enkel von Karl und Anna Louisa Neumeyer. Dem Ehepaar war vor knapp zwei Jahren, am 17. Juli 2019, vor ihrem ehemaligen Wohnhaus in München-Schwabing eine Erinnerungsstele gewidmet worden. Barbro Friberg, ebenfalls eng mit dem Ehepaar verwandt, war zu diesem besonderen Anlass eigens aus Schweden angereist.
Für die Enthüllung der Stele war der 17. Juli nicht zufällig ausgewählt worden. An diesem Tag im Jahr 1941 nahmen sich Karl und Anna Louisa Neumeyer gemeinsam das Leben. Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde, die das Ehepaar als kleines Kind noch persönlich kennengelernt hatte, kann den selbstbestimmten Tod nachvollziehen: »Für sie gab es keine Rückzugsorte mehr, keine Refugien, kein rettendes Ufer und keinen Silberstreif am Horizont. Die Verzweiflung, die daraus erwuchs, teilten nahezu alle jüdischen Familien jener Zeit.«
verbindung Mit München und seiner jüdischen Gemeinde ist der Name Neumeyer eng verbunden. Karl Neumeyer war vor der Machtergreifung der Nazis Dekan der Juristischen Fakultät der Universität München, Begründer des internationalen Verwaltungsrechts und Autor bahnbrechender juristischer Werke. Ihrer Zeit voraus war auch seine Ehefrau Anna Louise, die sich für Frauenrechte starkmachte. Ab 1901 war sie Mitglied des »Vereins für Fraueninteressen« und damit eine Vorreiterin für Gleichberechtigung.
Alfred Neumeyer, Karls Bruder, stellte sich in den Dienst von Religion, Tradition und Gemeinschaft. Bis ins Jahr 1941 leitete er den Verband Israelitischer Kultusgemeinden in Bayern und war Vorsitzender der Münchner Gemeinde.
Die erzwungene »Silberabgabe« war ein Element des staatlichen Raubzugs.
Faktoren wie berufliche Anerkennung und gesellschaftliches Engagement spielten nach der Machtergreifung der Nazis keine Rolle mehr. Bereits 1934 wurde Karl Neumeyer von der Universität in den Zwangsruhestand geschickt, nur weil er Jude war. Danach begann die systematische Zerstörung der Familie. Die erzwungene »Silberabgabe«, ein Element des staatlichen Raubzugs, war ein weiterer Schritt auf dem Weg in den Tod. Dazu entschloss sich das Ehepaar, das bereits alles verloren hatte, als sich noch mehr Einschränkungen abzeichneten – die Übersiedlung ins Barackenlager Milbertshofen und schließlich die Deportation.
Schicksale Derartige Schicksale bestärken Matthias Weniger in seiner Überzeugung, die Restitution geraubter Gegenstände so weit wie nur irgend möglich voranzutreiben. »Das Zoom-Gespräch hat deutlich gemacht, welchen tatsächlichen Wert diese Objekte für die Familien haben. Der materielle Wert spielt dabei eine eher untergeordnete Rolle. Die Erinnerung, die damit verbunden wird, ist das eigentlich Wertvolle daran«, sagte Weniger.
Auch der Blick von Charlotte Knobloch geht weit über reine materielle Werte hinaus. »Jedes noch so kleine Stück Gerechtigkeit, das durch eine Restitution wiederhergestellt werden kann, beendet ein Stück Unrecht. Und das ist jeden Aufwand wert«, betont sie. Sie erinnert aber auch daran, dass die staatlichen Institutionen in der Verantwortung stünden, überall dort Gerechtigkeit wiederherzustellen und Ungerechtigkeit zu beenden, wo es ihnen möglich sei.
Der Umgang des Bayerischen Nationalmuseums mit Provenienzforschung und Restitution verdient nach Überzeugung der Gemeindepräsidentin Dank und Anerkennung. Damit werde unter Beweis gestellt, »dass die bleibende Verantwortung des Rechtsstaats gegenüber den Verbrechen des Unrechtsstaates angenommen wird«.
Die Veranstaltung ist unter diesem Link abrufbar.