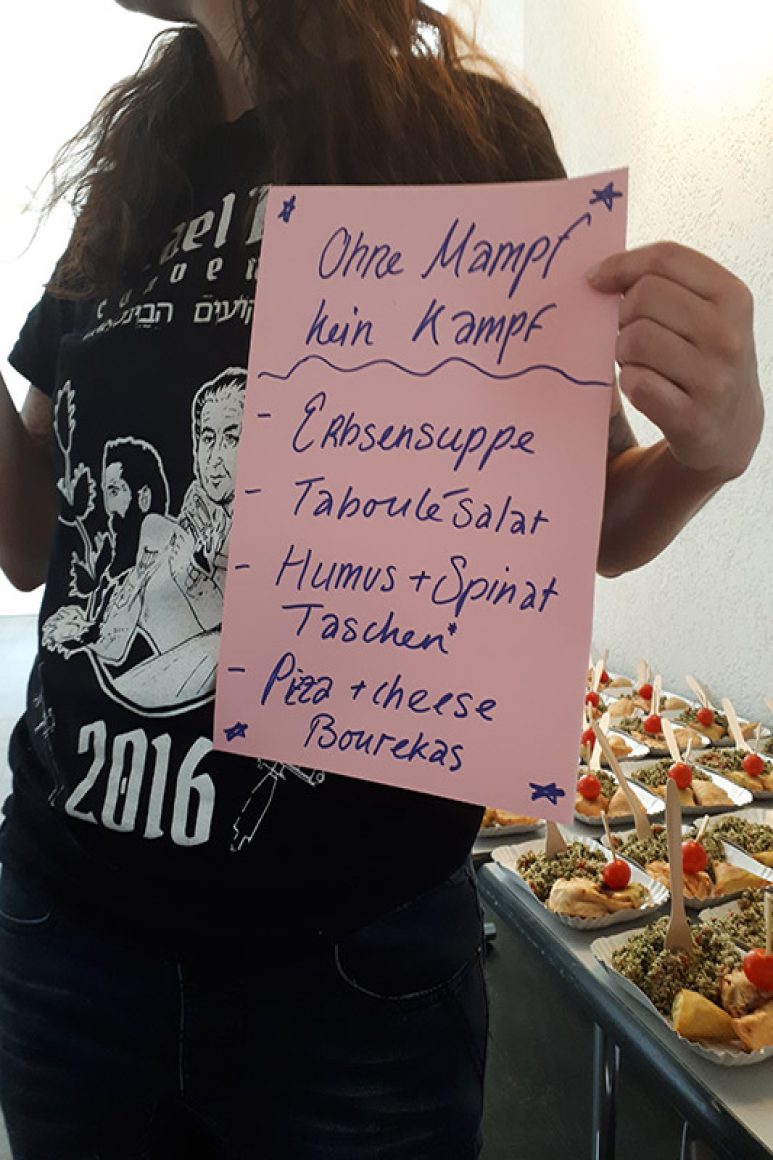Den Antisemitismus nimmt die Mehrheitsgesellschaft nach wie vor nicht ernst», sagt Irina Drabkina. Trotz der aktuell erhöhten medialen Aufmerksamkeit werde die Debatte weitgehend ohne die Betroffenen geführt. Bei dem von Drabkina federführend organisierten Fachtag der Antidiskriminierungsstelle ADA Anfang Mai in Bremen ging es genau darum: jüdischen Perspektiven ausreichend Raum zu verschaffen. «Schon die Vorbereitung des Fachtages hat mich empowert», sagt die 33-Jährige. «Dass nicht wieder nur ›über Juden‹ gesprochen wird, war sehr motivierend.»
Im Auftaktvortrag berichtete Benjamin Steinitz über die Herausforderungen bei der Erfassung und Dokumentation von Antisemitismus durch die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS). Daneben stellte er eine Typologisierung verschiedener Formen von Antisemitismus vor.
Anhand von prägnanten Beispielen legte er dar, inwiefern Post-Schoa-Antisemitismus, israelbezogene Formen oder antisemitisches Othering quer durch die weltanschaulichen Milieus bei Islamisten, Rechtspopulisten oder Linksliberalen zu finden sind. Als «antisemitisches Othering» bezeichnete Steinitz stereotypisierende Handlungen, Äußerungen und Gedanken, durch die Juden als grundsätzlich und unveränderbar anders als andere gesellschaftliche Gruppen imaginiert werden – so zum Beispiel ein Kommentar wie: «Du hast ja gar keine jüdische Nase.»
Steinitz’ Vortrag schuf eine gemeinsame Diskussionsgrundlage für die mehr als 120 Teilnehmer. «Leider haben viele Menschen gar keinen Begriff von Antisemitismus», beklagt Lehramtsstudent Simon Dietz. Für viele Kommilitonen sei Antisemitismus schlicht eine Art von Rassismus. Der 26-Jährige hält es deshalb für wichtig, nicht nur die Argumentationsmuster von Antisemiten in den Blick zu nehmen, sondern auch die dahinter stehenden Projektionsmechanismen.
Mikroaggression Zentrales Konzept in Debora Antmanns Vortrag zum Umgang mit dem Jüdischsein im Alltag war «Mikroaggression». Für den individuellen Umgang mit diesen alltäglichen Diskriminierungsformen empfahl Antmann die systematische Aufbereitung der Vorfälle auf Basis von Gedächtnisprotokollen. Allerdings fasste die Aktivistin unter «Mikroaggressionen» derart unterschiedliche Phänomene zusammen, dass dem Konzept die analytische Präzision verloren ging. Antmann zufolge reichen diese Abwertungen von mit Othering verbundenen sexuellen Übergriffen bis hin zu störenden Gesprächen im Publikum während ihres Vortrags.
Daneben versuchte Antmann, mit dem ironisch-identitätspolitischen Begriff des «WC-Deutschen» die deutsche Mehrheitsgesellschaft zur Selbstreflexion anzuregen. Dass sowohl die nichtjüdischen Deutschen als auch die hier lebenden Antisemiten keineswegs nur aus weißen Christen bestehen, gerät mit diesem Label aber aus dem Blick. Zudem besteht die Gefahr, Menschen mit den von außen zugeschriebenen Eigenschaften voll und ganz zu identifizieren – so, als wären Handeln, Denken und Emotionen schlicht auf weiße Hautfarbe und christliche Religionszugehörigkeit zurückzuführen.
Identität Nicht diskutiert wurde, wie es im Rahmen der von Antmann vertretenen Identitätspolitik möglich ist, politische Handlungsfähigkeit in Form von Allianzen und Konfrontation zu erzeugen – und damit über die heute in verschiedenen Zusammenhängen weit verbreitete identitäre Besinnung des Einzelnen auf sich selbst hinauszugehen.
Im Workshop, der sich mit dem Phänomen der Darstellung Israels beschäftigte, ging es um den Austausch über die eigene Wahrnehmung und um Erklärungen, warum viele Menschen derartig scharfe Kritik am jüdischen Staat üben. Als sich ein Teilnehmer als Anhänger der antisemitischen BDS-Kampagne beschrieb, weigerten sich andere, weiterhin mit ihm zu sprechen – der Workshop wurde deshalb in zwei separat diskutierende Gruppen aufgeteilt.
Trotz der auch aus Sicht der übrigen Diskutanten sehr hilfreichen und gut moderierten Debatte zeigten sich hin und wieder die Probleme einer auf dem Konzept der Narrative basierenden Herangehensweise, die den eigenen biografischen Zugang zu einem solchen Thema in den Vordergrund rückt. Denn einerseits gibt es von keinem biografischen Zugang umstößliche Fakten der israelischen Geschichte und Gegenwart, so etwa die Tatsache der jüdischen Präsenz in Palästina schon vor der israelischen Staatsgründung und der ersten zionistischen Einwanderungsphase.
Andererseits laufen auf dem Konzept der Narrative basierende Zugänge Gefahr, die physische Bedrohung von Juden, Israelis und als solchen Wahrgenommenen nicht ausreichend zu reflektieren. Das geschieht dann, wenn diese Zugänge nur auf der sprachlichen Ebene verbleiben und alle «Narrative» kritik- und kommentarlos nebeneinander gestellt werden. Ein krasses Beispiel: Auch Hamas-Funktionäre und Neonazis verfügen über einen individuellen biografischen Zugang zum Thema «Juden» – und sie streben danach, ihn in Form von gewalttätigen Handlungen in die Realität umzusetzen.
Schule Marina Chernivsky von der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden (ZWST) leitete zwei Sessions. In ihrem Vortrag thematisierte sie eindrucksvoll Antisemitismus im schulischen Kontext. Dieses Thema nahm auch viel Raum in ihrem Empowerment-Workshop für jüdische Teilnehmer ein. Hier wurde vor allem über die Angst vieler Eltern vor antisemitischem Mobbing ihrer Kinder in der Schule und einem unzureichenden Umgang damit durch die Lehrkräfte gesprochen. «Der Workshop hat mir gezeigt, wie wichtig dauerhafte Strukturen für den Austausch über den Umgang mit antisemitischem Mobbing sind», kommentiert die Teilnehmerin Elianna Renner.
Das Abschlusspodium befasste sich mit der Frage, ob es sinnvoll ist, als Konsequenz aus dem herrschenden Antisemitismus Deutschland und Europa zu verlassen – oder aber, ob ein Bleiben trotz allem möglich ist. Zur Einleitung wurde ein Auszug aus Mirna Funks Buch Winternähe vorgelesen – eine lebensweltliche und humorvolle Schilderung von alltäglichen Antisemitismuserfahrungen zwischen Koks und Fellatio in Berlin-Mitte. Die Diskussion war geprägt von Chuzpe und reflektierter Polemik.
flexibilität Neben Funk sprachen Lionel Reich vom Verband Jüdischer Studierender Nord, die Bloggerin Juna Grossmann und Irina Drabkina. Thematisiert wurden die Möglichkeiten für flexibilisiertes Leben an verschiedenen Orten durch das kurzfristige Anmieten von Ferienwohnungen (Airbnb), die Instrumentalisierung von muslimischem Antisemitismus durch die AfD und die immer wieder herbeifantasierte «christlich-jüdische Symbiose» in Europa.
Gerade vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen mit antisemitischem Othering à la «Du siehst ja gar nicht jüdisch aus» empfahl Lionel Reich mehrfach das Angebot von «Rent a Jew», der organisierten Begegnung von Nichtjuden mit Juden.
Alle Diskussionsteilnehmer problematisierten die Verengung jüdischer Identität auf Antisemitismuserfahrungen und machten deutlich: Eine einzige jüdische Perspektive gibt es ohnehin nicht – jedoch selbstbewusste Individuen, die kein Blatt vor den Mund nehmen und Position beziehen. Auch deshalb war der Fachtag wichtig.