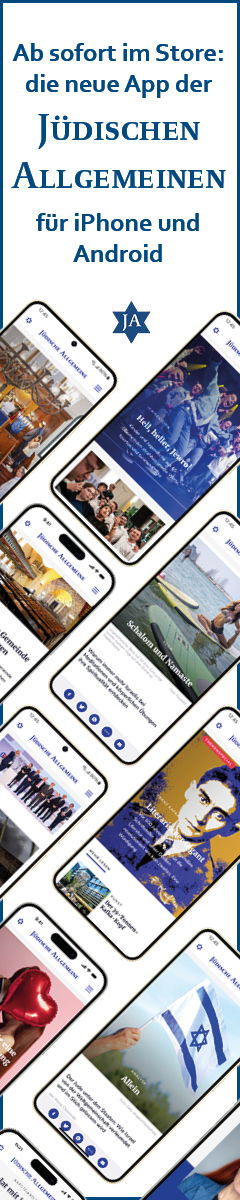Stundenlang standen wir zusammengepfercht in einem langen, dunklen Gang. Wir konnten nichts anderes tun als warten. Natürlich hatten wir große Angst vor dem, was da kommen würde. Wir spürten, dass diese demütigende Situation absichtlich herbeigeführt worden war.» So beschreibt Marie Jalowicz Simon die Situation in der Fontanepromenade 15 in ihrer Autobiografie Untergetaucht, die ihr Sohn Hermann Simon, Gründungsdirektor der Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum, 2014 veröffentlichte.
Im Frühjahr 1940 hatten die Nazis begonnen, Juden zur Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie zu verpflichten, im Juli wurde Marie Jalowicz zur «Zentralen Dienststelle für Juden», einem gesonderten Bereich des Berliner Arbeitsamtes, in die Fontanepromenade zitiert – als eine von 26.000 Berliner Jüdinnen und Juden.
kritik Auch die Schriftstellerin Inge Deutschkron erinnert sich an die Angst, die sie mit dieser Kreuzberger Adresse – auch «Schikanepromenade» genannt – noch immer verbindet. An diesem Morgen sitzt die 94-Jährige in ihrem Arbeitszimmer und beantwortet Briefe. «Ich bekomme immer viel Post von Kindern, die mein Buch Ich trug den gelben Stern in der Schule durchgenommen haben und mir dann schreiben», sagt sie. Sie antwortet jedem von ihnen.
Vor ein paar Tagen hat Deutschkron einen Brief geschrieben, der für Schlagzeilen sorgte. Adressiert ist er an Monika Herrmann (Die Grünen), Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, und an Klaus Lederer (Die Linke), Bürgermeister und Kultursenator von Berlin.
In ihrem Schreiben kritisiert die Autorin den Verkauf des Hauses in der Fontanepromenade sowie Pläne des neuen Besitzers für Wohnungen und Büros. Sie zähle zu den vielen Tausend Berliner Juden, begründet Deutschkron ihr Anliegen, für die dieser Ort Ausgangspunkt unsäglicher Leiden wurde. «Deshalb appelliere ich an Sie, sich dafür einzusetzen, dass dieses Gebäude eine Nutzung erfährt, die seiner historischen Bedeutung gerecht wird.»
graffiti Dass das Gebäude erst jetzt zu einem Politikum wird, wundert Stella Flatten. Denn vor dem Verkauf stand die Villa mehrere Jahre leer. «Der Bezirk hat es verpasst, dort einzuspringen und etwas daraus zu entwickeln», meint die Soziologin und Geografin, deren Engagement die vergessene Geschichte des Hauses überhaupt erst wieder ins Licht der Öffentlichkeit rückte: Graffiti an der Fassade nahmen im Laufe der Jahre zu; in den Holzbalken konnte ungestört der Schwamm wachsen. Weder Initiativen noch Politiker oder Historiker wurden öffentlich aktiv – außer der Anwohnerin Stella Flatten und den Mitarbeitern des Aktiven Museums Faschismus und Widerstand. Sie initiierten 2013 eine Gedenkfeier und das Anbringen einer Gedenkstele.
Daneben verwirklichte Stella Flatten ein temporäres Erinnerungsprojekt mit einer sogenannten Judenbank. Bei deren feierlicher Einweihung damals sagte Monika Herrmann, seinerzeit Bezirksstadträtin für Familie, Gesundheit, Kultur und Bildung: «Wir brauchen Orte der Erinnerung wie diesen.» Doch dann wurde das Haus, das unter Denkmalschutz steht, wieder sich selbst überlassen.
politikum Das änderte sich, als im vergangenen Herbst die Bauarbeiten begannen. Nun fordern die Initiativen «Wem gehört Kreuzberg» und «Gedenkort Fontanepromenade», gegründet im November 2016, einen sofortigen Baustopp. «Wir halten es für einen absoluten Skandal, dass ein solcher Geschichtsort der Immobilienspekulation geopfert wird und nicht als Gedenkort oder Museum zur jüdischen Zwangsarbeit und zum Holocaust öffentlich genutzt wird», kritisiert Lothar Eberhardt von «Gedenkort Fontanepromenade». Der Ort müsse «durch Kauf in öffentliche oder gemeinnützige Hand kommen, um einen würdigen und geschichtsbewussten Umgang» zu erfahren.
Auch Johannes Tuchel, Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, zeigt sich erstaunt. «So einen Vorgang hätte ich im Jahr 2016 nicht mehr für möglich gehalten.» Er sei fassungslos. Monika Herrmann möchte sich zum Politikum Fontanepromenade nicht mehr äußern. Auch der neu gewählte Berliner Senat hält sich bedeckt. Daniel Bartsch, Pressesprecher von Klaus Lederer, sagte der Jüdischen Allgemeinen, man sei gerade dabei, mit den Initiativen einen Gesprächstermin zu finden.
Kulturstadträtin Clara Herrmann bekundete derweil Interesse an «einem würdigen Gedenken vor Ort» und ist für weitere Vorschläge offen. Der Jüdischen Allgemeinen sagte sie, die Fontanepromenade 15 sei «für den Bezirk ein Ort von zentraler Bedeutung».
leerstand Das Haus in der Fontanepromenade wurde 1906 von der Berliner Fuhrwerks-Genossenschaft eingeweiht. Die Nazis richteten darin 1938 die «Zentrale Dienststelle für Juden» ein. Nach der Schoa ging es in den Besitz der «Reorganisierten Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage» über, der weltweit zweitgrößten Mormonengemeinschaft mit Hauptsitz in Missouri (USA). Als Eigentümer wurde Bischof Leslie Gelapp aus Missouri beim Katasteramt eingetragen. Bis 2010 fanden dort Gottesdienste statt; seit sechs Jahren steht es leer.
2014 erwarb ein Investor das Gebäude und inserierte es 2015 für 800.000 Euro. Weder das Land Berlin noch der Bezirk sahen Handlungsbedarf, es zu kaufen und eine Gedenkstätte daraus zu machen. «Wir hatten uns in das Haus verliebt», meint Architekt Marc Brune.
Seine Firma, ein Familienunternehmen aus Bremen, das sich auf die Sanierung von alten Häusern spezialisiert hat und überwiegend auf der Nordseeinsel Norderney in der Hotel- und Gastronomiebranche tätig ist, kaufte das Haus 2015. «Das Gebäude würde in nächster Zeit zusammenfallen, wenn es nicht saniert wird», meint Brune. «Die Ausschreibung hing in einem Schaukasten», erinnert er sich. «Es wurde als Zweifamilienobjekt vorgestellt, die Bauvoranfrage zum Umbau war dabei.»
stele Doch Brune schwebte etwas anderes vor. So soll der Grundriss erhalten bleiben. Zudem arbeitet die Firma eng mit der Unteren Denkmalschutzbehörde zusammen: So werde sich die Nutzfläche auf etwa 250 Quadratmeter belaufen.
Auch mit der Nazi-Vergangenheit des Hauses habe er sich auseinandergesetzt. «Wir haben eine jüdische Mitarbeiterin, mit der wir darüber gesprochen haben. Sie meinte, dass sie persönlich keine Berührungsängste damit hätte und kein Problem darin sehe.» Das habe für ihn den Ausschlag gegeben.
Die Stele soll bleiben. Auch plane er, das Haus zum «Tag des Offenen Denkmals» zu öffnen. Ganz wichtig sei es den Bauherren, die Vergangenheit zu würdigen und sichtbar zu machen. «Wir haben unserer Geschichte gegenüber eine Verantwortung», argumentiert Brune. Er könne sich vorstellen, dass Architekten seiner Firma einen Teil beziehen, während der andere vermietet wird. «Ich würde mich freuen, wenn eine jüdische Institution nachfragen würde.» In den nächsten Tagen trifft er sich mit der Initiative «Gedenkort Fontanepromenade».
gedenken Andreas Nachama, Direktor der Stiftung Topographie des Terrors, betont, dass das Haus ein «Ort der Täter» sei – nicht der Opfer. Auf jeden Fall aber solle die Erinnerung an dessen Geschichte wachgehalten und der Opfer gedacht werden. Auch er lehnt wie Inge Deutschkron Wohnungen ab, aber solange «etwas Seriöses» dort einziehe, habe er damit «kein Problem». «Der Ort muss sichtbar gemacht werden, ähnlich wie das bei der früheren Synagoge in Steglitz umgesetzt wurde.» In deren ehemaligen Räumen arbeiten heute Rechtsanwälte, aber die Spiegelwand auf dem Platz davor verweist auf die Geschichte. «Vielleicht könnte die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit für einen symbolischen Mietzins in die Fontanepromenade einziehen», schlägt Nachama spontan vor.
Anja Siegemund hingegen sieht eine Nutzung des Ortes als Gedenkort eher skeptisch. «Ob da ein weiterer Gedenkort in Berlin eingerichtet werden sollte oder eher eine andere Form der Erinnerung angebracht ist, ist genau zu überlegen», meint die Direktorin der Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum. Sie hält es aber für angebracht, «Beteiligte, Initiativen und auch Vertreter bestehender Gedenkorte in Berlin an einen Tisch zu bringen».
Demütigung Spezifisch für die Fontanepromenade sei es, dass es sich «um einen Ort der täglichen Demütigungen» handelt. Es sei ein «Ort der Täter, und zwar der Täter auf mittlerer und kleiner Ebene, nicht der großen Namen». Daher findet sie es wichtig, solche Orte zu kennzeichnen. «Denn ohne die aktive Mitwirkung auf diesen Ebenen hätten die Entrechtung, Ausgrenzung und schließlich der Mord an den Juden nicht durchgeführt werden können.»
Hermann Simon sieht das ähnlich zurückhaltend. Wichtig sei, dass der Ort gekennzeichnet bleibe, «sodass für jedermann die Geschichte dieses Hauses erfahrbar ist». Auch eine kleine Ausstellung im Eingangsbereich kann sich Marie Jalowicz’ Sohn vorstellen. Dies sollte jedoch von den neuen Nutzern initiiert werden.