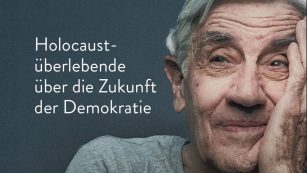Frau Kuklinski, Sie sind Beraterin mit Schwerpunkt Antidiskriminierungsarbeit bei SABRA. Wie sieht Ihr Alltag aus?
Ich berate Personen, die von Antisemitismus und oder Rassismus betroffen sind. Wir arbeiten in einem kleinen Beratungsteam mit zwei anderen Kolleginnen und Kollegen. SABRA selbst ist größer: Wir haben mehrere Projekte und machen Workshops und Fortbildungen für Gruppen, Lehrkräfte und verschiedene Institutionen.
Haben Sie dabei ein besonderes Aufgabengebiet?
Wir arbeiten häufig mit Schulen zusammen; unsere Fortbildungsformate richten sich an Lehrkräfte, Schulleitungen und im Bildungsbereich Tätige – also an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, nicht an Schülerinnen und Schüler. Auch haben wir in unserem Team drei abgeordnete Lehrkräfte.
Sollte bei der Ausbildung von Lehrkräften bereits im Studium mehr in Richtung Antisemitismus-Prävention getan werden?
Die Frage ist sehr klar zu beantworten: Ja. Das Thema Antisemitismus spielt in der Ausbildung so gut wie gar keine Rolle. Auch wird jüdisches Leben höchstens im Religionsunterricht besprochen. Natürlich kommen Jüdinnen und Juden im Geschichtsunterricht vor, aber genau das ist das Problem: fast nur im Geschichtsunterricht. Jüdisches Leben in Deutschland nach 1945 wird eigentlich gar nicht besprochen. Man muss sich die Frage stellen, was das für jüdische Menschen heute bedeutet: Was heißt es, wenn das Judentum ausschließlich auf seine religiöse Komponente beschränkt und der ganze kulturelle Teil des Judentums außen vor gelassen wird? Ich befürchte, dass es auf fehlende Sensibilität und fehlendes Wissen hinausläuft. Und genau das kann ein Faktor dafür sein, dass sich Antisemitismus verstärkt.
Wie nehmen Sie bei SABRA die Situation nach dem 7. Oktober 2023 wahr?
Wir haben sehr viele Anfragen bekommen, weil auch viele Schulen sehr überfordert waren. Vor allem in der Betroffenenberatung merken wir, dass etliche Fälle sich auch auf den 7. Oktober beziehen, konkret im Kontext des israelbezogenen Antisemitismus stehen. Eine große Komponente ist auch der sogenannte Post-Schoa-Antisemitismus, der beispielsweise Jüdischsein mit dem Nationalsozialismus gleichstellt.
Ihre Mutter saß bei dem Anschlag am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn vor 25 Jahren gerade im Deutschunterricht und bekam die Explosion mit. Was löst dieser Anschlag bei Ihnen heute aus?
Die Zielgruppe waren Menschen wie meine Mutter, die aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen waren. Wäre ich damals Sprachschülerin gewesen, hätte es auch mich treffen können. Dieser Anschlag berührt mich nicht nur deswegen, weil ich davon mittelbar betroffen war –, sondern weil ich besonders durch meine Arbeit bei SABRA immer wieder merke, dass sich seitdem kaum etwas verändert hat, was den Antisemitismus in Deutschland angeht.
Wann haben Sie zum ersten Mal von dem Anschlag erfahren?
Im vergangenen Jahr erst. Ich sprach mit meiner Großmutter allgemein über meine Arbeit, und wir haben in diesem Zusammenhang über das Thema Antisemitismus geredet. Ich war sehr überrascht, als sie sagte, dass meine Mutter und mein Großvater dort in der Nähe waren und diesen Anschlag mitbekommen haben. Ich wusste natürlich, was dort vor 25 Jahren geschehen war, aber dass Teile meiner Familie so nah dran waren, das wusste ich nicht.
Warum, vermuten Sie, haben die Familien so lange nichts gesagt?
Ich denke, dass es etwas mit dem familiären Hintergrund, mit der jüdischen Identität von Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion zu tun hat. Meine Mutter erzählte, dass sie als Kind in der Schule gehänselt wurde, weil sie jüdisch ist. Es gab diese negative Seite der jüdischen Identität – selten eine positive Seite. Im Alltag jüdisch zu sein, das war verboten, denn Religion war verboten. Deswegen konnte das jüdische Leben in der Ukraine, wo ich herkomme, gar nicht richtig gelebt werden. Meine Mutter sagt, sie habe erst viel später verstanden, dass auch sie eines der Opfer des Wehrhahn-Anschlags hätte sein können.
Waren Sie kürzlich am S-Bahnhof Wehrhahn?
Ich habe jahrelang in der Nähe gewohnt. Früher wurde die kleine schwarze Gedenktafel ganz oft mit Stickern beklebt oder beschmiert. Offenbar haben Menschen diese Tafel nicht mit einem Anschlag in Verbindung gebracht – oder die Tragweite dieses Ortes verstanden.
Was wünschen Sie sich für diesen Ort?
Dass er Menschen bewusst wird und dass er lebendig bleibt. Natürlich ist es ein Ort der Trauer: Ein ungeborenes Kind wurde ermordet, mehrere Menschen wurden schwer verletzt, und es hätten auch noch mehr Menschen dort sterben können. Es soll aber auch ein Ort sein, an dem man sich nachhaltig mit Antisemitismus auseinandersetzt.
Haben Sie das Gefühl, dass sich im Umgang mit Antisemitismus in Deutschland etwas verändert hat?
Was das Thema Rechtsextremismus angeht, hat die Sensibilität zugenommen. Gerade auch, was rechtsextreme Tendenzen in der Gesellschaft angeht. Beim Antisemitismus ist es allerdings so, dass er ja nie verschwunden war. Ganz oft gibt es dieses Bild: 1945, der Krieg ist vorbei, der Antisemitismus ist verschwunden. Das entspricht nicht der Realität. Nach 1945 gab es genauso eine Kontinuität von Antisemitismus wie vor 1933. Genau das zeigt ja der Wehrhahn-Anschlag. Judenhass hat die Eigenschaft, dass er sich anpassen kann. In den vergangenen Jahren hat er sich eher verstärkt, als dass er weniger geworden ist.
Hat Sie diese persönliche Erfahrung in der Familie darin bestärkt, bei SABRA zu arbeiten?
Auf jeden Fall. Ich bin mit einem nicht sehr klaren Verständnis, was es bedeutet, jüdisch zu sein, aufgewachsen. Als Jugendliche habe ich mich natürlich gefragt: Wer bin ich eigentlich, wie lebe ich meine Identität? Ich komme aus der Ukraine, meine Muttersprache ist Russisch, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Es waren Fragmente, die damals nicht so richtig zusammenpassen wollten. Erst vor einigen Jahren habe ich angefangen, mich mit der jüdischen Seite meiner Identität zu beschäftigen. Das hat dann auch dazu beigetragen, dass ich mich nun beruflich mit dem Thema beschäftige.
Was schätzen Sie denn an Ihrer Arbeit?
Ich finde es sehr wichtig, dass man den Betroffenen zuhört, weil wir oftmals die Einzigen sind, die ihnen glauben. Ganz häufig kommen Menschen zu uns, die berichten, dass ihnen nicht geglaubt wird. Wir sind dann diejenigen, die die Betroffenen unterstützen. Meine Kolleginnen und Kollegen und ich merken: Sie ziehen etwas daraus, sie fühlen sich empowert, unterstützt – allein dadurch, dass wir versuchen, ihnen zu helfen. Auch wenn die Außenwelt meistens mit Ablehnung oder Abwehr reagiert: Es ist wichtig für die Betroffenen zu wissen, dass jemand für sie da ist.
Mit der Referentin der Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit, Beratung bei Rassismus und Antisemitismus (SABRA) sprach Katrin Richter.