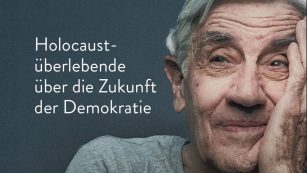Herr Wagner, wann haben Sie vom bevorstehenden Besuch der Queen in Bergen-Belsen erfahren?
Erste Kontakte mit dem Buckingham-Palast, der britischen Botschaft und der niedersächsischen Staatskanzlei gab es im April, also relativ kurzfristig. Kurz vor den Gedenkveranstaltungen zum 70. Jahrestag der Lagerbefreiung gab es eine erste Vorbesichtigung durch die Briten.
Wie bereiten Sie und Ihre Mitarbeiter sich darauf vor?
Es ist natürlich ein logistischer Aufwand. Wir mussten Gruppen umbuchen, die sich für diesen Tag angemeldet hatten, und die Gedenkstätte bleibt bis zum Nachmittag für die Öffentlichkeit geschlossen. Für die Kollegen aus der Forschungsabteilung und der Dokumentation ist es aber ein ganz normaler Arbeitstag.
Gehört der Besuch in der Gedenkstätte zum offiziellen Programm der Königin?
Ja, aber er hat dennoch eher privaten Charakter: Die Königin kommt ausdrücklich auf eigenen Wunsch nach Bergen-Belsen. Der offizielle Staatsbesuch endet in Berlin. Auf dem Heimflug legt sie dann einen Zwischenstopp in Niedersachsen ein – extra für den Besuch der Gedenkstätte.
Was genau werden Sie ihr zeigen?
Das Außengelände mit den Denkmalanlagen. Viel mehr Zeit haben wir nicht – die Queen wird eine gute halbe Stunde bleiben. Das ist natürlich recht kurz – das Dokumentationszentrum und die Dauerausstellung etwa bleiben komplett außen vor. Was sehr schade ist, denn genau dort dokumentieren wir auch Zeugnisse britischer Soldaten, die Bergen-Belsen am 15. April 1945 befreit haben – in aller perspektivischen Breite und Differenzierung.
Welche Rolle spielt Bergen-Belsen im kollektiven Bewusstsein der Briten?
Eine sehr große! Interessanterweise gilt in Großbritannien nicht Auschwitz, sondern Bergen-Belsen als der Symbolort für die Schoa schlechthin. So begründete Großbritannien 1999 die Nato-Intervention im Kosovo mit »Nie wieder Bergen-Belsen« – darin zeigt sich die Wirkungsmächtigkeit dieses Ortes im historischen Gedächtnis der Briten.
Wie erklären Sie sich diesen Stellenwert?
Nach der Befreiung richtete die britische Armee in Bergen-Belsen Nothospitale ein, wo die Soldaten und das britische Rote Kreuz die Überlebenden aufopferungsvoll pflegten. Später halfen sie, die Überlebenden im DP-Camp unterzubringen, dem Areal für Displaced Persons.
Wie nutzen Sie die mediale Aufmerksamkeit des Queen-Besuchs, um Inhalte auch jenen Teilen der Gesellschaft zu vermitteln, die sich nicht für Gedenkkultur interessieren?
Wir haben mit Hochdruck eine Webseite zum Queen-Besuch erarbeitet, mit vielen Fotos und Quellen. Darin geht es fokussiert um die Bedeutung von Bergen-Belsen für die Briten, aber auch um Fragen wie: Wieso wurde Bergen-Belsen von den Briten befreit? Welcher Anblick bot sich den Befreiern? Natürlich bietet dieser Besuch auch eine Chance, historische Inhalte zu vermitteln – und auch andere Seiten der Queen zu zeigen, nicht nur die Farbe ihres Hutes.
Zum Beispiel?
Elizabeth war 1945 Mitglied im Auxiliary Territorial Service, der Frauenabteilung des britischen Heeres. Es waren unter anderem ihre Kameradinnen, die die Befreiten in Bergen-Belsen gesund pflegten.
Reagieren Zeitzeugen anders beim Besuch der Gedenkstätte als junge Leute?
Wer wie die Queen einen eigenen biografischen Bezug hat, reagiert emotionaler. Die Queen war damals in London – aber sie hätte genauso gut auch aktiv bei der Befreiung von Bergen-Belsen dabei sein können.
Werden Sie, trotz strengen Protokolls, Gelegenheit zu persönlichen Worten haben?
Ich werde die Königin begrüßen und sie über das Gelände führen. Ich bin kein Protokoll-Experte. Doch wenn sich ein Gespräch ergeben sollte, wäre das durchaus ein Anknüpfungspunkt.
Mit dem Leiter der Gedenkstätte Bergen-Belsen sprach Katharina Schmidt-Hirschfelder.