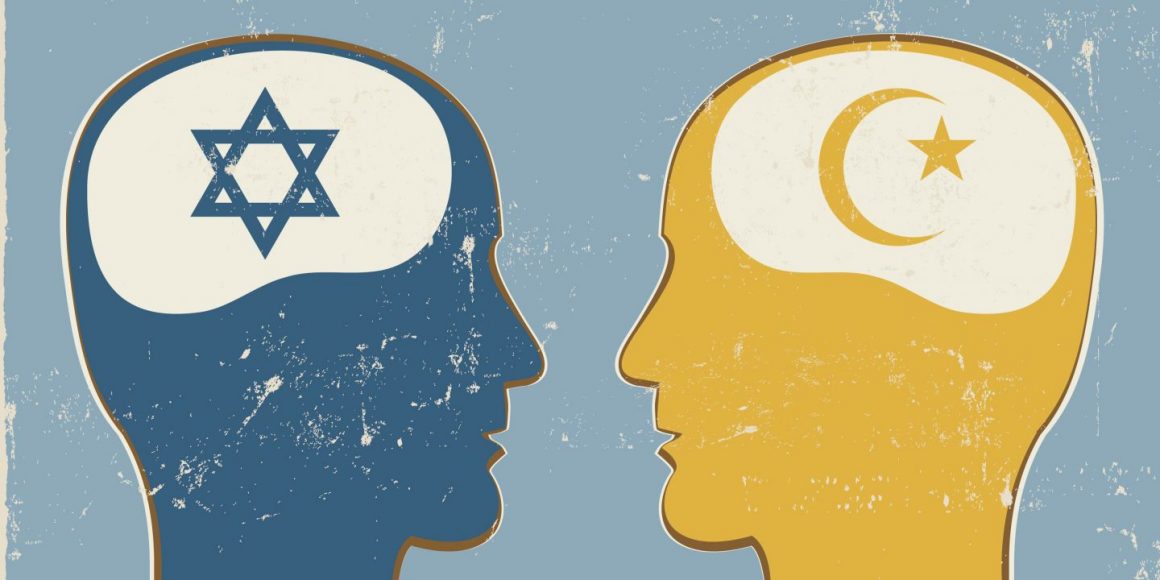»Nur die Anderen füllen alle Friedhöfe, nur den Anderen sind alle Denkmäler aufgestellt, nur die Anderen bewahrt unser dankbares Gedächtnis auf«, sagte der russische Philosoph des Dialogs, Michail Bachtin (1895–1975), vor knapp 100 Jahren. In Europa und Deutschland gibt es einen radikal »Anderen«, den Deutschland und Europa zunächst komplett ausrotten wollten und den sie heute dialogisch suchen: die Juden.
Nach Bachtin ergänzen »die Anderen« den Beobachter, sie helfen ihm oder ihr, sich selbst zu vervollständigen. Können das die 150.000 Jüdinnen und Juden dieses Landes mit ihren eigenen dramatischen Überlebens-, Abstiegs- und Migrationsbiografien? Juden als »Trümmerfrauen« deutscher Ängste und Sorgen?
Eine solche gesamtnationale erinnerungspolitische Familienaufstellung ist nicht zu realisieren. Zumal gar nicht die Juden von heute, die Annas, Alexanders, Tals, Chagits und Dmitrijs als Dialogpartner gesucht werden.
Bücherregale Nein, die Einsteins, Kafkas, Hannah Arendts werden in Deutschland imaginär gefragt. Wenn »die Anderen« seit Langem Friedhöfe (oder Bücherregale) füllen – kann man dann von ihnen lernen? Gewiss. Durch ihre Bücher und Ideen. Das Gedenken der Opfer der Schoa ist dabei entscheidend. Die unvoreingenommene Suche nach Schuldigen in den eigenen Familiengeschichten sollte unbedingt dazu gehören. Denn auch die Nazis kamen nicht vom Mond.
Einen Dialog sollte die Gesellschaft mit lebendigen Juden führen, die hier und heute präsent sind. Seit dem Jahr 321 leben die Juden nachweislich auf dem Gebiet des heutigen Deutschland. Sie gehören dazu, und dennoch gab es laut Zentralratspräsident Josef Schuster keinen wirklich feierlichen Anlass zum »Jubilieren« in diesem dramatischen Corona-Jahr 2021. Zu präsent sind antisemitische Verschwörungsmythen in unserer Gesellschaft, die heute zu unsicher, zu gespalten ist.
Deswegen, so Schuster, kein Jubeljahr, sondern lieber ein nachdenkliches Jahr, das große Errungenschaften der deutschen Juden, aber auch »tiefste Abgründe« der deutsch-jüdischen Geschichte reflektiert und jetzt sinnvoller- und erfreulicherweise in die Verlängerung geht.
Einen Dialog sollte die Gesellschaft mit lebendigen Juden führen.
Die Verlängerung ist folgerichtig, denn Jüdinnen und Juden von heute kennt die nichtjüdische Mehrheitsgesellschaft nach wie vor kaum. Die neue Integrationsbeauftragte des Bundes, Reem Alabali-Radovan, twitterte kürzlich über den Tag der Migranten: Für sie sei er 365 Tage des Jahres. Die Aussage unterstreicht, dass es noch viel zu tun gibt weit jenseits der notwendigen symbolischen Daten. Das können auch die vielen postsowjetisch-jüdischen Migrantinnen und Migranten in unseren jüdischen Gemeinden zweifelsohne bestätigen.
Realismus Bei all diesen Herausforderungen: Wie können Jüdinnen und Juden an Dialogen beteiligt sein? Die zweieinhalb Jahre des jüdisch-muslimischen Zentralratsprojekts »Schalom Aleikum« lehren: nicht größenwahnsinnig, sondern realistisch bleiben, analysieren – und Vertrauen schaffen.
Um realistisch zu bleiben, so unsere erste Maxime, gehört ein klares Verständnis dazu sowie Geduld dafür, dass eine theologische und/oder gesellschaftliche Revolution als Folge der dialogischen Begegnungen nicht möglich sein wird. Die Anzahl der Menschen, die heute Juden und den Zentralrat für offene Zeitgenossen und nicht für eine kalte Festung der Dauerempörten halten, ist auf der muslimischen Seite nachweislich numerisch größer geworden.
Wir sprechen bei »Schalom Aleikum« nicht nur mit Juden oder Muslimen. Nein, wir sprechen mit der deutschen Gesellschaft von heute, wir brechen mit der unnötigen Konstruktion »die Deutschen und wir«. Wir sind Deutschland!
maxime Die zweite Maxime ist die sprachlich-analytische. Wir versuchen, die nicht selten symbolpolitisch codierte Sprache des Dialogs zu transformieren. Hierfür braucht man eine analytische Grundlage. Dialog ist keine Wissenschaft – doch Wissenschaft, nicht zuletzt die Soziologie, hilft dem Dialog. Und der Gesellschaft.
Die dritte Maxime ist das Vertrauen. Wir haben im jüdisch-muslimischen Dialog gelernt, dass Vertrauen nicht zu einem bestimmten Datum beantragt werden kann. Vertrauen schaffen ist ein Prozess, der auch sehr viel mit Bildung und nicht zuletzt mit der breiten Öffentlichkeit der sozialen Netzwerke zu tun hat.
Denn wir können weder die antisemitischen noch die antimuslimischen Vorurteile ad hoc abbauen, noch die langen Familiengeschichten umschreiben, die eine anti-israelische beziehungsweise antisemitische Erzählung seit Generationen pflegen.
Respekt Wir können den Menschen aber sagen: »Du bist willkommen. Wir brauchen dich, so wie du bist. Du wirst hier nicht vorgeführt, sondern als Person respektvoll angesprochen.« Ich kann bestätigen – das funktioniert. Nicht immer, aber immer besser.
So geht der neue Dialog hoffentlich auch 2022 in einem Deutschland weiter, das nicht die abstrakten »Anderen« sucht, sondern sich selbst findet.
Dmitrij Belkin ist promovierter Historiker und beim Zentralrat der Juden tätig, wo er das jüdisch-muslimische Dialogprojekt »Schalom Aleikum« leitet.