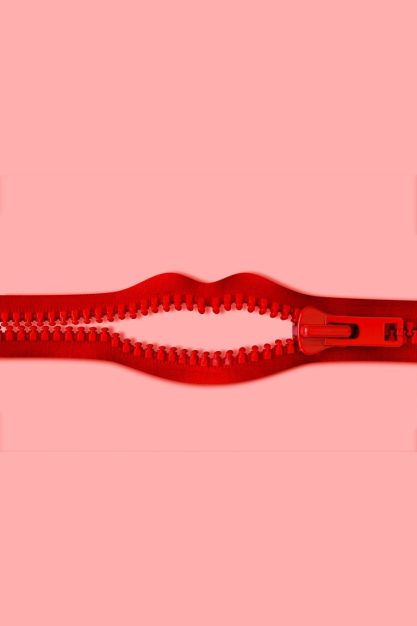Eine Mischna warnt vor einem Verhalten, das vielen Menschen harmlos erscheinen mag: »Jose Ben Jochanan, ein Mann aus Jerusalem, sagt: Pflege nicht zu viel Geschwätz mit der Frau. Sie sagten es bezüglich der eigenen Frau – um wie viel mehr mit der Frau des Nächsten!
Daher sagten die Weisen: Wer zu viel Geschwätz mit der Frau pflegt, bereitet sich Unheil, lässt ab von den Worten der Tora, und es kann sein Ende sein« (Pirkej Awot 1,5).
PLAUDERN Die Anweisung, »plaudere nicht zu viel mit der Frau«, wurde wiederholt als frauenfeindlich bezeichnet – einer solchen Deutung liegt jedoch ein Missverständnis zugrunde! Dass Ehepartner miteinander reden sollen, ist selbstverständlich; die Wichtigkeit einer guten Kommunikation zwischen Mann und Frau haben unsere Weisen oft hervorgehoben. Der Tannait Jose Ben Jochanan will lediglich darauf aufmerksam machen, dass bestimmte Formen der Plauderei aus guten Gründen zu vermeiden sind. Erst recht sollte ein Mann Tändeleien mit fremden Frauen meiden, denn unnötiges Schwätzen kann unerwünschte Folgen haben.
Einst zitierte Berurja, die berühmte Ehefrau von Rabbi Me’ir, Jose Ben Jochanans Ausspruch. Der Talmud berichtet: »Rabbi Jose der Galiläer ging auf dem Weg, und als er Berurja traf, fragte er sie: ›Über welchen Weg geht man nach Lud?‹ Da erwiderte sie ihm: ›Dummer Galiläer, die Weisen sagten doch, dass man nicht viel mit einer Frau rede; du solltest besser sagen: Welcher nach Lud?‹« (Eruwin 53b).
Nach Ansicht von Rabbiner Ovadia Josef, dem früheren sefardischen Oberrabbiner Israels (1920–2013), hat sich Berurja gegenüber Rabbi Jose nicht korrekt verhalten. Der Tannait hat keineswegs geschwätzt; die unfreundliche Zurechtweisung war deplatziert.
Geschwätzigkeit unter Männern ist nicht anders zu beurteilen als Geschwätzigkeit zwischen Mann und Frau.
Geschwätzigkeit unter Männern ist nicht anders zu beurteilen als Geschwätzigkeit zwischen Mann und Frau. Maimonides, der Rambam (1038–1204), empfiehlt in seinem religionsgesetzlichen Kodex: »Der Mensch schweige viel. Er rede entweder ein Wort der Weisheit oder über Dinge, die das tägliche Leben betreffen.« Kritisch fügt der große Halachist und Philosoph hinzu: »Das Gespräch der meisten Menschen ist aber als überflüssig anzusehen« (Hilchot De’ot 2,4).
Schutzzaun Warum hat Maimonides diese Beobachtung notiert? Um auf einen Umstand hinzuweisen, den viele Menschen korrigieren könnten.
Von Rabbi Akiwa stammt der Ausspruch: »Ein Schutzzaun für die Weisheit ist Schweigen« (Pirkej Awot 3,17). Ein absolutes Schweigen kann der Tannait sicher nicht gemeint haben, denn von den Worten der Tora heißt es: »Und schärfe sie deinen Söhnen ein und sprich von ihnen, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg wanderst, wenn du liegst und wenn du aufstehst« (5. Buch Mose 6,7). Man soll also bei vielen Gelegenheiten über Verse der Tora reden.
Rabbiner Samson Raphael Hirsch (1808–1888) erklärt, Rabbi Akiwa habe »jene Kunst des Schweigens gemeint, die lieber nichts spricht, als etwas Unnützes oder nicht wohl Erwogenes zu äußern, die lieber zuhört, um von den Ansichten anderer Nutzen zu ziehen«. Manchmal soll man schweigen, aber in bestimmten Situationen ist es durchaus angebracht, das Wort zu ergreifen.
Bleibt noch die Frage zu klären: Wieso schützt Schweigen die Weisheit? Rabbiner Selig Bamberger (1872–1936) gab folgende Erklärung: »Das beste Mittel zur Erhaltung der bereits erlangten Kenntnisse und Lebensweisheiten ist das Schweigen bei unnützen Unterhaltungen oder das stille Nachdenken über das Erlernte, um dieses dem Gedächtnis einzuprägen.«
Eine Beteiligung an unnützen Gesprächen kann sich, wie die eingangs zitierte Mischna lehrt, als schädlich erweisen, da man von Worten der Tora ablässt. Reflexionen hingegen sind beim Erwerb von Weisheit unerlässlich. Rabbi Akiwas Bemerkung über das Verhältnis von Weisheit und Schweigen macht darauf aufmerksam, dass bereits angeeignete Weisheit durch stilles Nachdenken vertieft und vor Entstellungen geschützt werden kann.