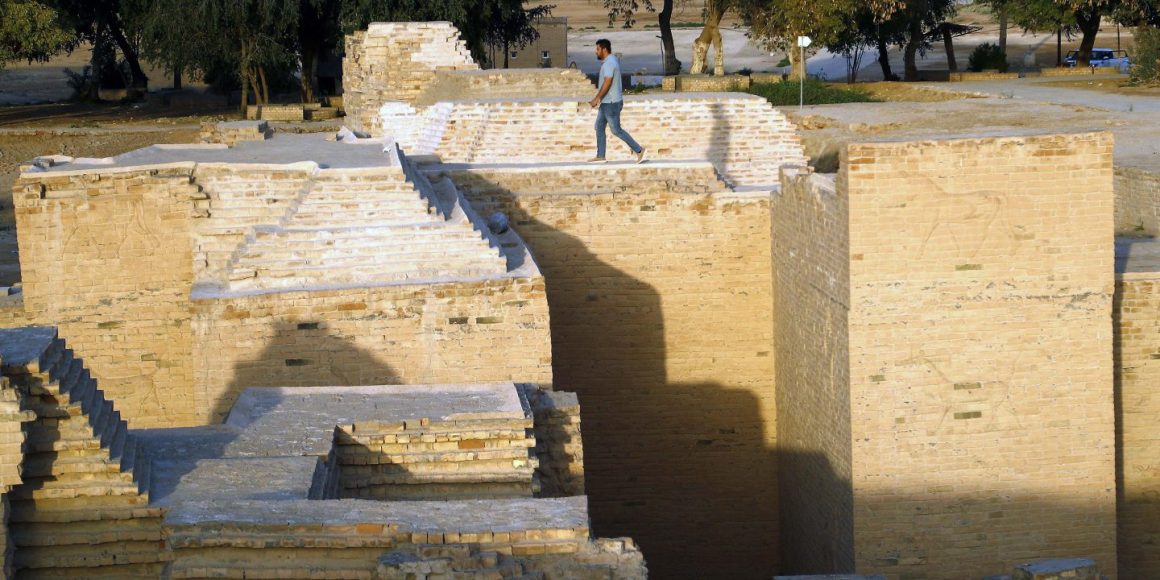Der Talmud stellt im Traktat Sanhedrin 24a eine sehr spannende Frage: »Was bedeutet das Wort ›Bavel‹ (Babylon)?« Die Antwort lautet: »Rabbi Jochanan sagt: Der Name bedeutet, dass (dieses Land) vermischt ist (belula) mit der Schrift, vermischt mit der Mischna und vermischt mit dem Talmud.«
Auf den ersten Blick heißt dies, dass es in Babylon viele Lehrhäuser gab, das Land also »vermischt mit Lehrhäusern« war und die Vorhersehung dazu geführt hat, dass man davon den Landesnamen »Bavel« ableitete, und zwar von dem hebräischen Wort »belula«, was auf Deutsch so viel wie »vermischt« bedeutet.
Der Talmud fährt an dieser Stelle fort und lehrt: »Er hat mich in Finsternis versetzt wie die, die längst tot sind« (Eicha 3,6) – Rabbi Jirmija sagt: Dies ist der Babylonische Talmud.»
«Bavel» – Babylon. Was hat es damit auf sich?
Der Talmud sagt über sich selbst, dass er mit einem Vers über die Finsternis des Todes zusammengefasst werden kann und verbindet diese eigenartige Aussage mit der Erklärung der Wortherkunft des Wortes «Bavel» – Babylon. Was hat es damit auf sich? Zunächst einmal lässt sich die Frage stellen, wieso der Talmud überhaupt nach der Wortherkunft fragt. Sie wird doch bereits im Text der Tora erklärt: «Darum nannte man die Stadt Bavel, denn dort hat Gʼtt die Sprache aller Welt verwirrt (hebräisch: balal), und von dort aus hat er sie über die ganze Erde zerstreut» (1. Buch Mose 11,9).
Laut der Tora heißt Babylon also so, weil nach dem Turmbau zu Babel alle Sprachen verwirrt wurden und der Name selbst vom Wort für «verwirren» (balal) abgeleitet wurde. Im modernen Hebräisch lautet das Wort im Infinitiv «lebbalbel».
Laut der Tora stammt das Wort Bavel von «verwirren», laut dem Talmud von «vermischen». Beide Wörter sind sinnesverwandt, ergänzen einander. Wenn man verwirrt ist, sind die Dinge vermischt. Wenn man Dinge vermischt sieht, dann ist man verwirrt. Beide Begriffe sind auch sinnverwandt mit dem Vers: «Er hat mich in Finsternis versetzt.» In der Finsternis, wenn das Licht nicht scheint und die Dinge unklar sind, kann es zur Vermischung von Tatsachen und dadurch zur Verwirrung kommen.
Die hebräische Sprache lässt eine alternative Übersetzung der oben zitierten talmudischen Stelle zu: «Was ist Bavel? Rabbi Jochanan sagt: Eine Vermischung in der Schrift, eine Vermischung in der Mischna, eine Vermischung im Talmud. In der Finsternis (…) dies ist der Babylonische Talmud.»
Der Text könnte also auch aussagen, dass die Schrift selbst eine Vermischung, ein Element der Verwirrung in sich trägt. Jeder, der den Babylonischen Talmud studiert hat, weiß, dass es ein Schriftwerk ist, das sich selbst ständig relativiert, hinterfragt, und man bis zum Ende einer talmudischen Diskussion und manchmal auch darüber hinaus nie einen endgültigen Schlussstrich ziehen kann, sich also keine definitive Aussage zur Meinung des Talmuds machen lässt.
Kein Lehrbuch, sondern ein Gedankenlabyrinth
Man kann die Tora, die Mischna oder den Talmud nie lesen und aus der Lektüre eine praktische Handlungsanweisung ableiten, ohne den gesamten Diskussionsprozess nachvollzogen zu haben.
Die Weisen haben den Talmud absichtlich so konzipiert, dass man stets nach der Wahrheit erst suchen muss und in diesem Prozess der Suche immer wieder falsche Schlüsse ziehen kann. Sie haben unser heiliges Buch also nicht wie ein Lehrbuch geschrieben, sondern eher wie ein Gedankenlabyrinth.
König Schlomo vergleicht die Tora mit dem Licht (Mischlei 6,23). Das meiste Torastudium geschieht im Babylonischen Talmud, der sich selbst mit der Finsternis vergleicht. Die Botschaft ist klar: Der Text an sich kann Finsternis sein. Unsere Auseinandersetzung mit ihm bringt aber Licht in diese Finsternis. Das macht aus dem einfachen Lesen des Talmuds die Mizwa des Torastudiums.
Wir leben in einer fragmentierten Welt und sind aufgefordert, die Einheit des Schöpfers zu erkennen. Der Talmud versetzt uns in die Lage, mithilfe von Verwirrung und Vermischung diese Fragmentierung zu durchschauen und das Licht der Klarheit in die Finsternis dieser Fragmente zu bringen. Auf diese Weise kann Tikkun, die Reparatur unserer Seelen und der gesamten Welt, herbeigeführt werden. So wie die Weisen lehren: «Das Studium der Tora wiegt alles auf.»