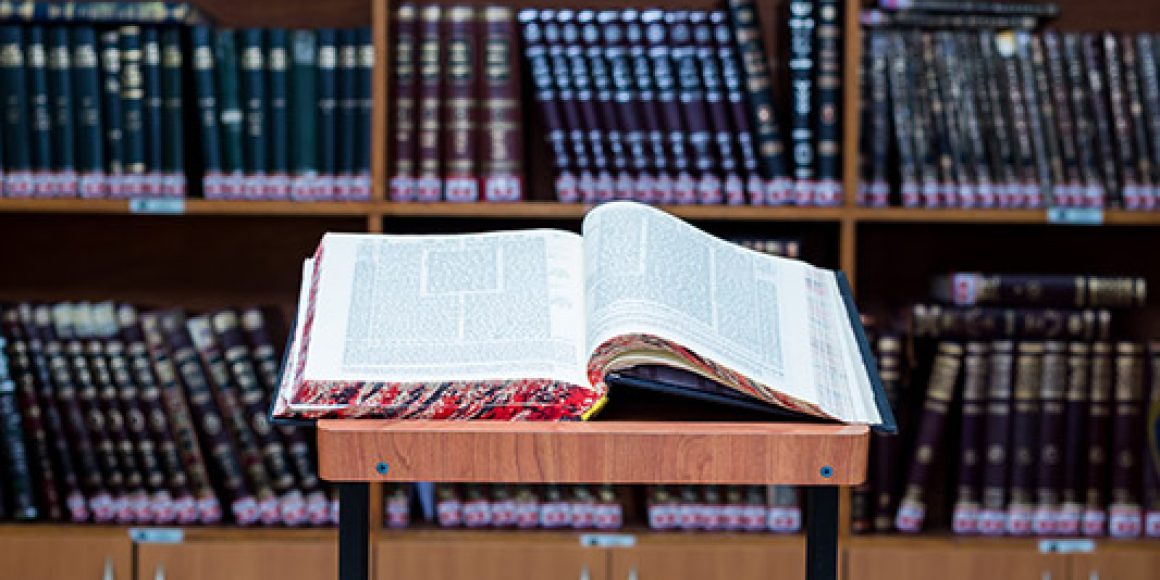Der Talmud steckt voller Diskussionen, halachischer Entscheidungen und Geschichten. Da ist es schwierig, an eine bestimmte Stelle zu springen und einen Satz für sich allein stehen zu lassen ohne seinen Kontext. Aber so geschieht es in der Regel bei Zitatsammlungen. Man will das vermeintlich Beste präsentieren, damit der Laie sich nicht seitenweise durch rabbinische Schlagabtäusche kämpfen muss.
Die beliebteste Fundgrube ist das Traktat »Pirkej Awot«, die sogenannten Sprüche der Väter. Hillels »Wenn ich nicht für mich bin, wer ist für mich, und bin ich nur für mich, was bin ich, und wenn nicht jetzt, wann dann?« (Pirkej Awot 1,14) ist bestimmt schon Zigtausende Male zitiert worden.
Zitatsammlungen Aber es gibt auch andere Zitatsammlungen. Haben die einen die Absicht, die »Highlights« des Talmuds zu präsentieren, so wollen andere die schlechten Seiten des Judentums zeigen – oder das, was man dafür hält.
Im deutschsprachigen Internet wird man auf der Suche nach Zitaten ohne Mühe auf eine hässliche Sammlung stoßen, die aus dem Jahr 1931 stammt. Trotzdem behauptet jeder, der diese Art von Zitaten neu zusammenstellt, er habe sich selbst »in die Materie eingearbeitet«. Doch viele bedienen sich des Buches Der Talmud in nichtjüdischer Beleuchtung des ungarischen Journalisten Alfons Luzsénszky.
Hier wird oft Baba Batra 54b zitiert mit dem Satz: »Die Güter der Nichtjuden gleichen der Wüste, sie sind ein herrenloses Gut, und jeder, der zuerst von ihnen Besitz nimmt, erwirbt sie.« Oft steht dann, der Satz fände sich auch an anderer Stelle des Talmuds, nämlich in »Choschen Hamischpat«. Doch dies ist kein Teil des Talmuds, sondern einer der vier Turim des Schulchan Aruch.
Aus dem Kontext gerissen, könnte man bei diesem Zitat schnell auf den Gedanken kommen, Juden sei es erlaubt, sich nichtjüdischen Besitz unter den Nagel zu reißen, und sie würden damit nicht gegen die Halacha, das Religionsgesetz, verstoßen.
Diskussion Doch schaut man genau hin, sieht man, dass dieser Satz, wie so oft im Talmud, Teil einer Diskussion ist: Wann hat man für den Kauf ein Eigentumsrecht erworben? Um das zu diskutieren, beginnt Rabbi Jehuda im Namen von Schmuel: »Die Güter der Nichtjuden sind der herrenlosen Wüste gleich. Jeder, der sich ihrer bemächtigt, hat sie erworben.« Dann fährt der Talmud mit der naheliegenden Frage fort: »Warum?«
Die Begründung folgt: »Sobald der Nichtjude das Geld erhalten hat, ist er von seinem Gut befreit.« Er hat also die Zahlung erhalten, und ihm gehört die Sache nicht mehr.
Und der jüdische Partner in der Transaktion? Der Talmud sagt: »Der Käufer aber erwirbt nicht eher, bis der Kaufvertrag in seine Hand gelangt.« Es könnte (!) also einen kurzen Moment geben, in dem die Ware verkauft ist, aber noch nicht dem Käufer gehört. Dieser Zeitraum ist hier gemeint, und das bekräftigt der Text im Anschluss daran erneut: »Darum sind sie, die Güter, der Wüste gleich, und jeder, der sich ihrer bemächtigt, hat sie erworben.«
eigentümer Käme also jemand anderes an einem verkauften Feld vorbei, dann dürfte er es bearbeiten, und es würde ihm gehören – dadurch, dass er es bearbeitet. Denn es gehörte ja nicht mehr dem Vorbesitzer und noch nicht dem späteren Eigentümer.
Diese ungünstige Situation versucht Abaji abzuschwächen und sagt: »Hat denn Schmuel das so gesagt? Er hat doch auch gesagt: ›Das Staatsgesetz ist Gesetz.‹ Der König hat aber angeordnet, dass Felder durch einen Kaufvertrag erworben werden können.« Man dürfe sie also nicht durch reine Bearbeitung in Besitz nehmen.
Diese skurrile und theoretische Situation wurde so durch das Verschweigen des Kontextes zur Propaganda gegen das Judentum, und seine angebliche Agenda gegen Nichtjuden hält sich nun bereits seit 87 Jahren.