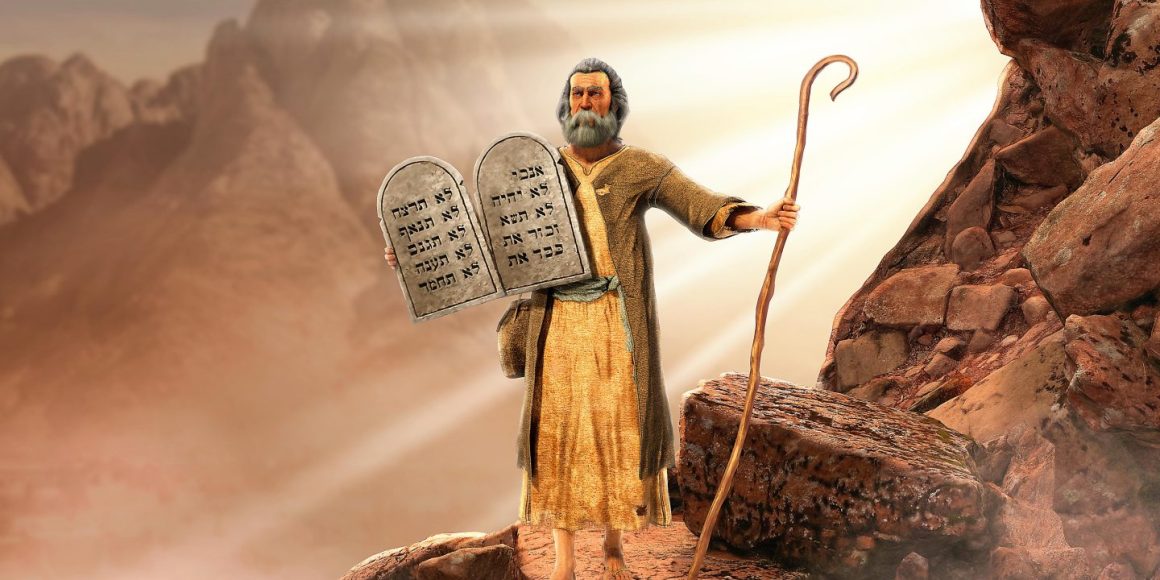Vor rund 3500 Jahren wurde der Telegrammstil erfunden: »Töte nicht!«, »Begeh keinen Ehebruch!«, »Stiehl nicht!«. Kürzer kann man diese drei der Zehn Gebote nicht formulieren. Im Wochenabschnitt Jitro kommen sie gegen Ende vor. Sobald der Vorbeter diese Gebote vorliest, erheben sich die Betenden von ihren Sitzen.
Einige werden sich vielleicht darüber wundern, warum ausgerechnet diese Gebote in die beiden Bundestafeln gemeißelt wurden. Die Rabbiner weisen häufig darauf hin, dass auf der ersten Tafel fünf Gesetze festgehalten werden, die das Verhältnis des Menschen zu Gott definieren: zum Beispiel, keinen fremden Gott anzubeten und den Schabbat einzuhalten. Auf der anderen Tafel stehen die Gesetze, die die menschliche Zivilisation garantieren sollen. Eine Gesellschaft, die Mord und Raub gutheißt, hat keinen Bestand.
Ein Unterschied zwischen den beiden Tafeln zeigt sich auch im Umfang. Während die ersten fünf Gesetze sehr ausführlich beschrieben werden, sind die anderen fünf kurz gehalten. Wir werden später darauf zurückkommen.
status Im Judentum haben die Zehn Gebote einen unklaren Status. Sie sind nicht wichtiger als die anderen Vorschriften, aber durch ihre prominente Erwähnung in der Tora eben doch etwas Besonderes. Nach dem Auszug aus Ägypten, der Spaltung des Schilfmeers und der Wüstenwanderung kann man sie als vierte Wegmarke des jüdischen Volkes verstehen.
Die Menschen lagerten ein paar Tage am Berg Sinai. Bald wird Mosche hinaufsteigen und die Tora empfangen. Bestimmt machte sich eine große Angespanntheit im Volk breit. Was wird uns da von Gott angeordnet? Was werden wir noch essen dürfen? Wie viele Frauen sind erlaubt?
Ausgerechnet in dieser nervösen Phase betritt Jitro das Wüstenlager. Schwiegereltern kommen eigentlich immer in ungünstigen Momenten, aber ausgerechnet jetzt, in der wichtigsten Phase des jüdischen Volkes?
Jitro ist in Begleitung. Er hat seine Tochter, Mosches Frau, und ihre beiden gemeinsamen Kinder mitgenommen. Mosche wird sich bestimmt gefreut haben. Vielleicht hat er sich aber auch gefragt: Hätte es nicht ein paar Tage später sein können?
ratschläge Jitro ist ein Typ Mensch, der gern Ratschläge gibt. Er beobachtet, wie sein Schwiegersohn von Fragestellern überrannt wird: Ist das koscher? Jitro sieht, wie sich Mosche aufreibt. Er sagt zu ihm: »Es ist nicht gut, wie du es machst« (2. Buch Mose 18,17) und schlägt ihm vor, die Rechtsprechung auf mehrere Schultern zu verteilen.
Mosche soll also nur als höchste Instanz fungieren und, ähnlich wie der Bundesgerichtshof, lediglich die letzten Entscheidungen fällen. Dieser Rat kommt im richtigen Moment. Denn welchen Wert haben die Gesetze der Tora, wenn die praktische Rechtsprechung in sich zusammenfällt, weil nur ein überforderter Richter zur Verfügung steht?
Mosche lässt sich vom Stress nicht beeindrucken. Der mittelalterliche Kommentator Raschi beschreibt die Szenerie, als Jitro im Lager ankommt: Mosche empfängt seinen Schwiegervater persönlich, nicht etwa durch einen Diener. »Und weil er das tat, kamen auch Aharon und dessen Söhne und schließlich das ganze Volk.«
zusammentreffen Die Tora verwendet mehr Textzeichen für die Beschreibung des Zusammentreffens mit Jitro als für die Zehn Gebote. Auch heißt unser Wochenabschnitt eben »Jitro« und nicht »Zehn Gebote«. Man hat beinahe den Eindruck, der kurze Besuch Jitros sei wichtiger als die Zehn Gebote.
Wäre diese Vermutung so abwegig? Das Judentum versteht sich als eine Religion des Tuns. Am Ende des Tages steht immer die Frage: Habe ich die Gesetze der Tora studiert oder gelebt? In keiner anderen Situation zeigt sich Mosches wahre Größe. Jeder hätte verstanden, wenn er Jitro nicht persönlich begrüßen würde. Andere Persönlichkeiten hätten die Tage vor dem Verkünden der Tora zur Meditation genutzt und ein Schild mit »Bitte nicht stören!« an ihr Zelt gehängt.
Bei alldem hatte Mosche die Geduld, dem Schwiegervater, einem Götzendiener, die jüdischen Gesetze zu erklären und dessen Ratschlag anzunehmen. »Niemals erstand in Israel dem Mosche gleich ein Prophet«, heißt es im Lied »Jigdal«, das sich bei uns auf den ersten Seiten des Gebetbuchs befindet.
Eigentlich enthält die Tora keine Prophezeiungen Mosches. Im Gegenteil, häufig lag er falsch. Er durfte nicht das Land Israel betreten, obwohl er inständig darum bat. Er lag in seiner Einschätzung auch häufig falsch, wenn es um das jüdische Volk ging.
HIRTE Das Wesen Mosches kann man mit den beiden Gesetzestafeln vergleichen und verstehen. In seiner Beziehung zu Menschen war er kompromisslos und eindeutig. Als Jugendlicher hatte er gesehen, wie ein ägyptischer Soldat einen Juden brutal misshandelte. Ohne lange nachzudenken, erschlug Mosche den Aufseher. Als Hirte kam ihm kein Schaf zu Schaden. Und als sein Schwiegervater ihn in der Wüste aufsuchte, war dem größten Propheten klar, dass man ihm persönlich die Hand reicht.
In seinem Verständnis zu Gott hingegen wirkt er hadernd, fragend und zögerlich. Mehr noch: Er streitet mit Ihm. Will nicht das Volk befreien, mag kein Anführer sein. Nur ungern tritt er an Pharao heran. Gott muss ihn warnen. Noch eine Wiedersetzung – und dann! Auch die erste Bundestafel enthält Warnungen: »Ich bin ein eifersüchtiger Gott«, »Ich ahnde die Schuld der Väter an den Kindern«.
Bei der anderen Tafel finden wir das nicht. Keine Warnung: »Wenn du jemanden tötest, wirst auch du hingerichtet.« Man muss nicht alles ausbuchstabieren.
Wer aber Mosche als Vorbild nehmen möchte, fährt gut. Die Gesetze sind wichtig, doch wer sich in der Theorie ins letzte Detail verliebt, hat das Wichtigste nicht verstanden: ein ehrlicher Jude zu sein, der sich als Teil der Zivilisation sieht. Und der für Mitmenschen einsteht, ohne lange nachzudenken.
Der Autor ist Journalist in Zürich und hat an Jeschiwot in Gateshead und Manchester studiert.
inhalt
Die Tora stellt Mosches Schwiegervater, den midjanitischen Priester Jitro, als religiösen und weisen Menschen dar. Er rät Mosche, Richter zu ernennen, um das Volk besser zu führen. Die Kinder Israels lagern am Fuß des Berges Sinai und müssen sich drei Tage lang vorbereiten. Dann senkt sich Gottes Gegenwart über die Spitze des Berges, und Mosche steigt hinauf, um die Tora zu empfangen.
2. Buch Mose 18,1 – 20,23