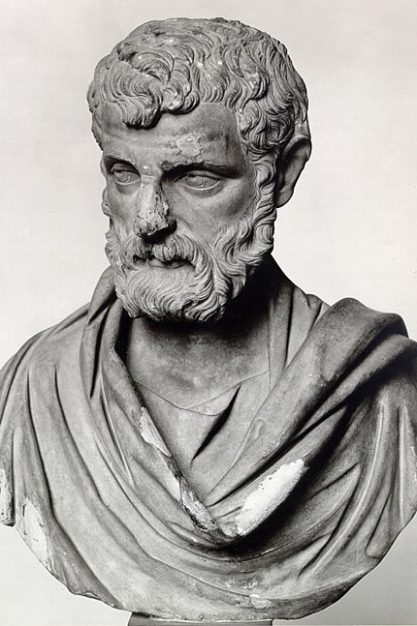Zweifellos ist Herodes eine der umstrittensten Figuren der biblischen Geschichte. Für die einen ist er »Hordus Harasha«, der böse Herodes. Ein brutaler Herrscher und Kindermörder. Für die anderen verkörpert er den brillanten Feldherrn und ideenreichen Baumeister: Herodes der Große. Einige bezeichnen ihn als »Nichtjuden«, anderen hingegen gilt er als »jüdischer König«. Auch als »Melech rodef weraduf« ist er in die Literatur eingegangen, ein König, der verfolgte und gleichzeitig selbst verfolgt wurde.
Wer also war Herodes? Das Jerusalemer Israel-Museum will dieser Frage nachgehen und widmet ihm im kommenden Jahr eine, wie es heißt, »weltweit einmalige« Ausstellung. Sie präsentiert Herodes als einen der größten Bauherren aller Zeiten. Schließlich ist er es, der den Zweiten Tempel in Jerusalem umgestaltet, die Burg auf Masada, das Herodion, den Palast in Jericho, den Hafen von Caesarea und vieles mehr gebaut hat. Auf der 400 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche im Museum soll das 2008 von Professor Ehud Netzer entdeckte Grab des Herodes auf dem Herodion mitsamt seinem Sarkophag rekonstruiert und erstmals öffentlich vorgestellt werden. Das sagte Kurator Dodi Mevorach unlängst bei einem Archäologiesymposium in Jerusalem.
fundstücke In enger Kooperation zwischen den Archäologen und Mitarbeitern des Israel-Museums seien Tausende Fundstücke, teilweise tonnenschwer, direkt vom Herodion ins Museum gebracht worden. Dort wurden Stuckdecken und Fragmente von Secco-Wandmalereien aus dem »Privattheater« des Herodes in mühseliger Puzzle-Arbeit wieder zusammengefügt und restauriert.
Die wunderbar geschmückte königliche Loge des Herodes ist erstaunlich gut erhalten geblieben, weil Herodes sie angeblich nur aus Anlass eines Staatsbesuches aus Rom errichten und kurz danach wieder zuschütten ließ, um neben dem Theater sein monumentales Mausoleum errichten zu können. Von dem Mausoleum steht nur noch das fein gemeißelte steinerne Podest. Aber die Säulen und Verzierungen sowie der mutwillig zertrümmerte Sarkophag des Herodes aus rötlichem Sandstein sind alle in situ gefunden worden, sodass das Bauwerk vollständig wieder rekonstruiert werden kann.
josephus flavius Mevorach sagte bei dem Symposium, dass im Museum das Staatsbegräbnis des Königs nachgestellt werden solle. Diese Zeremonie ist vom römisch-jüdischen Historiker Josephus Flavius bis ins letzte Detail beschrieben worden. Dabei wurde auch erwähnt, dass Legionäre aus »Gallien und Germanien« das Ehrenspalier stellten, als der König auf einer goldenen Bahre zum Mausoleum getragen wurde. Ein israelischer Archäologe bei der Tagung sagte auf Anfrage, dass in der Begräbnisbeschreibung auch Thraker erwähnt worden seien. Obgleich keine typischen Waffen oder Uniformen der Germanen oder Gallier gefunden worden seien, habe man Waffen der Thraker entdeckt. Deshalb gelte die Beschreibung des Flavius als historisch echt und zuverlässig.
Im Gegensatz dazu scheint die Erwähnung Herodes’ im Neuen Testament eher auf christliche Propaganda als auf historische Fakten zurückzugehen. Denn Herodes wird dort im Zusammenhang mit dem Kindermord in Bethlehem erwähnt. Forscher glauben, diese Geschichte ist frei erfunden. Zweifellos sei Herodes grausam gewesen und habe im Rahmen von Machtkämpfen auch Familienangehörige ermordet. Doch das sei damals in den Herrscherhäusern sehr verbreitet gewesen.
kindesmord Dem Evangelium des Matthäus zufolge soll er »in Bethlehem und seiner ganzen Umgebung alle Knaben im Alter von zwei Jahren und darunter« getötet haben. Das Ziel sei gewesen, den »neugeborenen König der Juden« zu beseitigen. Herodes gilt wegen des Kindermordes bei Christen als Inbegriff eines grausamen Königs. Aber auch bei Juden war Herodes höchst umstritten und wurde angefeindet.
Fest steht, dass er die Anerkennung der Juden durch den prachtvollen Umbau des Jerusalemer Tempels suchte. Entsprechend des rabbinischen Rates riss er die vorhandene Konstruktion nicht ab, sondern errichtete rund um das bestehende Heiligtum den sagenhaften Tempel, von dem der Talmud schwärmt: »Wer das Bauwerk des Herodes nie gesehen hat, der hat nie ein schönes Bauwerk gesehen.«
Herodes war »König, Monster, Bauherr«, wie das Magazin »Spiegel« 2009 schrieb. 2013 wird man mehr über ihn erfahren – in der Ausstellung des Jerusalemer Israel-Museums.