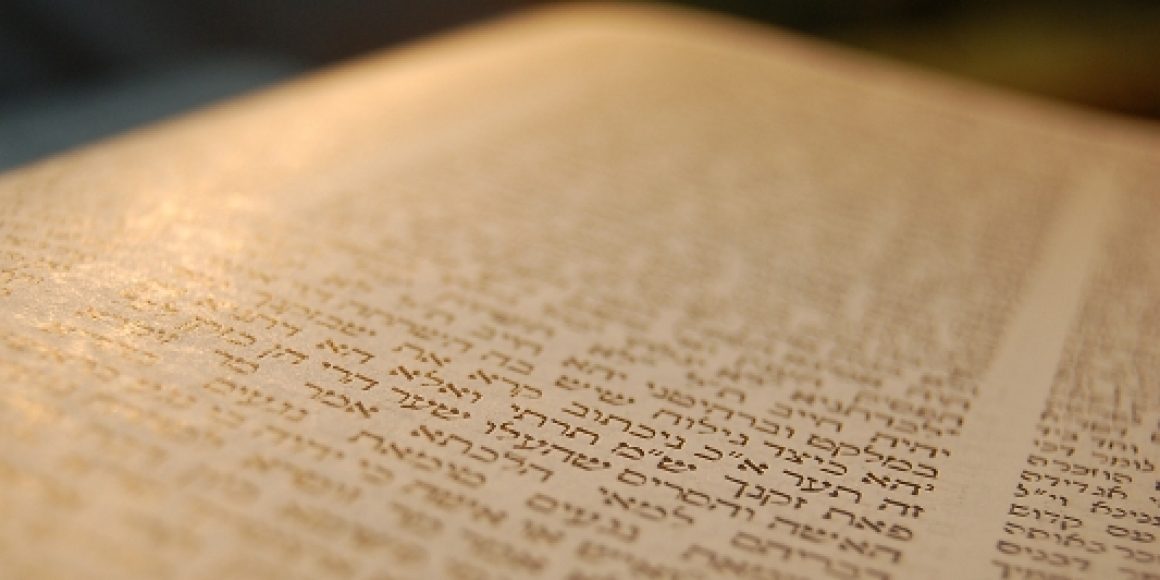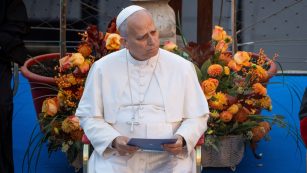Ob neben dem Daddeln, Googeln, dem Absondern von Tweets und den sozialen Netzwerken in unserer Welt noch Platz ist für die Gedanken der Weisen? Yizhak Ahren plädiert nach seinem 2019 veröffentlichten Buch Worte der Weisen in seinem neuesten Buch unter dem Titel Gedanken der Weisen nachdrücklich für ihre Einsichten und Einblicke in das Leben des Menschen.
Leser dieser Zeitung werden sich an den einen oder anderen der 30 Texte, die hier versammelt sind, erinnern. Sie wissen auch bereits, dass Ahrens Texte in einer auf Aktualität ausgerichteten Zeitung nicht dazu dienen wollen, religiös-ethische Reflexionen aus einer vergangenen Epoche des Judentums zu vermitteln. Seine Glossen zur Gemara sind vielmehr als Brücken gedacht, über die hinweg die Weisen des Talmuds ihre Dispute in unsere Gegenwart hineintragen.
»GEWALTMENSCHEN« Das verdeutlicht in besonderer Weise der Text »Dialog mit Gewaltmenschen«. Als Resümee zweier sich ähnelnder Geschichten aus dem Talmud, in denen die Protagonisten jeweils mit gewalttätigen Menschen in Kontakt kommen und darüber in Zweifel geraten, ob ihr Verhalten nicht der Gewalttätigkeit dieser Menschen in die Hände gespielt hat, schreibt Ahren, es sei »in einer solchen Situation erlaubt, das Gebot der Wahrhaftigkeit zu übertreten, um die Übeltäter nicht zu reizen«.
Der Text »Verdienste des Kerkermeisters« vermag sogar die Forderung zu relativieren, sich in unserer von Antisemitismus geprägten Gegenwart offensiv für jüdische Werte einzusetzen. Der Prophet Elijah erkennt auf einem Marktplatz nur einen Menschen, der die zukünftige Welt betreten wird. Es ist ein vollkommen unauffälliger Mann, der wie ein Nichtjude auftritt. Weil er hauptsächlich mit Nichtjuden umgeht, hat er sich dieses Äußere ausgewählt. Dadurch kann er die anderen Juden rechtzeitig vor antisemitischen Übergriffen warnen. Ahren zieht aus diesem Verhalten den Schluss, »dass man unter gewissen Umständen sein Judesein nicht hervorkehren muss«.
Neben zahlreichen Gelehrten früherer Zeiten, die Ahren als Interpreten talmudischer Disputationen zitiert, erwähnt er auch Autoritäten der jüngsten Vergangenheit. In »Bitte um ein Wunder« ist es Rabbi Yitzhak Isadore Twersky (1930–1997). Diese Glosse erörtert ein mit der Spaltung des Schilfmeers vergleichbares Wunder: In Chullin 7a wird von einem Rabbi erzählt, der einem Fluss befiehlt, seine Wasser zu teilen.
WUNDER Das Schilfmeerwunder besitzt eine fundamentale Bedeutung für das jüdische Volk, weil es ein wichtiger Teil des Exodus ist. Es wirft jedoch einige problematische Fragen nach der Außerkraftsetzung der Naturgesetze auf. Um das Anliegen des Rabbis zu rechtfertigen, hat Twersky nach gewichtigen Gründen für die Außerkraftsetzung der Naturgesetze gesucht. Die Rettung eines Lebens, zu der der Rabbi unterwegs ist, ist ein solcher Grund.
Wunder sind also immer möglich. Jedoch ist der Mensch, wie Ahren betont, kein Zauberer. Allein Gott erwirkt Wunder, worum ihn aber ein wahrer Zaddik bitten kann.
Das Phänomen der Achtsamkeit steht in dem Text »Folgen einer unbeabsichtigten Kränkung« im Vordergrund. Ketubot 62b erzählt von einem Rabbi, der an einem anderen Ort als seinem Heimatort die Tora studiert und es versäumt, am Vorabend von Jom Kippur zu seiner Frau zurückzukehren. Daraufhin stürzt das Dach, auf dem er sitzt, zusammen, sodass er zu Tode kommt.
Für die Frage, warum der Rabbi ausgerechnet zu Jom Kippur nach Hause zurückzukehren pflegte, referiert Ahren die Meinung verschiedener Talmudlehrer, auch des heute in Deutschland lehrenden israelischen Dichters und Talmudgelehrten Admiel Kosman. Aber auch die Frage, ob nicht der Tod des Rabbis eine viel zu harte Strafe sei, da er, durch den endgültigen Verlust des Ehemannes, die Ehefrau mitbestrafe, lässt sich an diese Geschichte stellen.
KRÄNKUNG Auf eine weitere viel diskutierte Problematik macht Ahren aufmerksam. Ein Mensch, der einen anderen kränkt, kränkt damit letztlich auch sich selbst. Die Vielseitigkeit der negativen ethischen Aspekte, die sich aus dieser Erzählung herausarbeiten lässt, berechtigt Ahren dazu, als Resümee darauf hinzuweisen, »dass sogar ein beflissener Toragelehrter einen anderen Menschen verletzen kann«. Deshalb ist ein höchstes Maß an Achtsamkeit von jedem Menschen gefordert.
Die große Bedeutung dieser Geschichte wird auch dadurch unterstrichen, dass sie zum Thema einer Ballade der israelischen Gimzu Blues Band gewählt wurde. Mit diesem Hinweis auf ein Produkt der populären Kultur schlägt Ahren den großen Bogen von den gelehrten Disputationen talmudischer Zeit zu den kulturellen Medien unserer Tage. Seine meist nur drei Seiten umfassenden Glossen sind auf diese Weise ethische Schlaglichter auf Themenbereiche, die Vergangenheit und Gegenwart näher zusammenrücken.
Yizhak Ahren: »Gedanken der Weisen. Glossen zur Gemara«. Kiebitz Edition, Ramat Beit Shemesh 2021. 104 S., 10 €