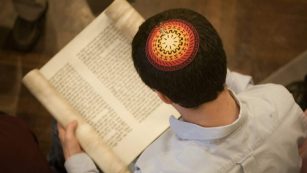Rabbiner Sacks, wie schätzen Sie das Verhältnis der Religionen zueinander in der Gegenwart ein?
Nach der Aufklärung hätte vermutlich niemand damit gerechnet, dass die Religionen eine so große Rolle in der globalen Politik des 21. Jahrhunderts spielen würden. Was wir jetzt erleben, lässt sich mit den Verhältnissen im 16. und 17. Jahrhundert vergleichen, mit der Zeit der Religionskriege. Es gibt aber eine ganz entscheidende Neuerung, die die gegenwärtigen Kriege und Krisen prägt: die Revolution der Informationstechnologie. Was damals Reformen, aber auch Kriege und Krisen beschleunigte, war der Buchdruck – heute sind es das Internet und insbesondere die sozialen Netzwerke.
Was können wir aus der Geschichte des 16. und 17. Jahrhunderts lernen?
Dass Kriege durch Waffen gewonnen werden, Frieden aber durch Ideen gewonnen wird. In meinem neuen Buch greife ich diese Erkenntnis auf und versuche, etwas zu entwickeln, das ich abrahamitische Theologie nenne – eine Art Fundamentaltheologie, die es allen drei abrahamitischen Religionen ermöglichen soll, auf einer gemeinsamen Basis jeweils individuelle Strukturen aufzubauen.
Solche Versuche hat es schon häufiger gegeben. Was ist neu an Ihrem Ansatz?
Werte allein sind nicht ausreichend. Es gibt universelle und partikulare Werte. Identität ist immer partikular, nie universell. Was bedeutet jüdische Identität beispielsweise? Gewiss nicht nur eine Sammlung universeller Werte. Nachdem man im 17. Jahrhundert das Partikulare zunächst versuchte, abzuschaffen, kam es im späteren 19. Jahrhundert wieder verstärkt auf und prägte besonders das 20. Jahrhundert, in Form von Nationalstaaten, Rassen oder politischen Ideologien. Die Nationalstaaten bescherten uns zwei Weltkriege, Rassentheorien den Rassismus, politische Ideologien den Nationalsozialismus und den Stalinismus. Über 100 Millionen Tote. Nach diesen Erfahrungen unternahm man den Versuch, das Partikulare wieder durch Universelles zu ersetzen. Heute ist das Universelle das Individuum. Das wird verehrt. Man schaue nur auf das omnipräsente »i«: iPod, iPad, iPhone und so weiter. Alles gilt als richtig, was für das individuelle Ich gut ist. Viele der gegenwärtigen Spannungen zwischen den Religionen, aber auch innerhalb säkularer Gesellschaften lassen sich hierauf zurückführen: auf die Aufgabe der Idee der Gemeinschaften, bis hin zur radikalen Individualisierung. Es gibt aber ein intrinsisches Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach Identität. Wenn dieses Bedürfnis bedroht ist, folgt Gewalt.
Wie schafft man es dann, dass Partikularinteressen nicht zu mehr Gewalt führen?
Seit Jahren schon plädiere ich für etwas, das ich die »Würde der Verschiedenheit« nenne. Unterschiede verleihen uns Würde. Um diese Unterschiede zu wissen und sie mit Würde anzuerkennen – darin liegt der Schlüssel für eine gelingende gemeinsame Verständigung. Mein neuer Versuch der abrahamitischen Fundamentaltheologie geht diesen Weg und setzt sich nur für eine gemeinsame theologische Basis ein. Und dies geschieht in meinem Buch durch eine tief religiöse Sprache, weil diese Sprache Juden, Christen und Muslime teilen.
Dabei könnten aber andere Religionen und säkulare Menschen auf der Strecke bleiben.
Das ist in der Tat ein Problem. Während mein Buch unter Juden, Christen und Muslimen großen Anklang findet, ärgert es auch manche nichtreligiöse Leserinnen und Leser. Es ist schließlich ein religiöses Buch. Wenn ich aber eine säkulare Gesellschaft erreichen möchte, dann durch das Erzählen von Geschichten. Geschichten sind eine universelle Sprache.
Lässt sich denn auf der Basis von Geschichten ein Dialog zwischen Religionen und Weltanschauungen führen?
Ich unterscheide zwischen Dialog »von Angesicht zu Angesicht« und Dialog »Seite an Seite«. Von Angesicht zu Angesicht ist zum Beispiel ein theologischer Dialog, und dieser kann ungemein schwierig sein. Seite an Seite ist ein ganz praktischer Dialog, der auch auf der Straße stattfindet, durch einen gemeinsamen Einsatz für die Zivilgesellschaft. Der Mitzvah Day ist hierfür ein gutes Beispiel: Menschen unterschiedlichster Traditionen kommen zusammen, um gemeinsam Gutes zu tun. Hieraus können Freundschaften entstehen, und Freundschaften überwinden Grenzen von Religionen und Weltanschauungen.
Das Gespräch führten Jo Frank, Geschäftsführer des Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks (ELES), und Johanna Korneli, Projektleiterin des interreligiösen ELES-Programms »Dialogperspektiven«. Das neue Buch von Rabbiner Jonathan Sacks »Not in God’s Name: Confronting Religious Violence« ist 2015 erschienen.