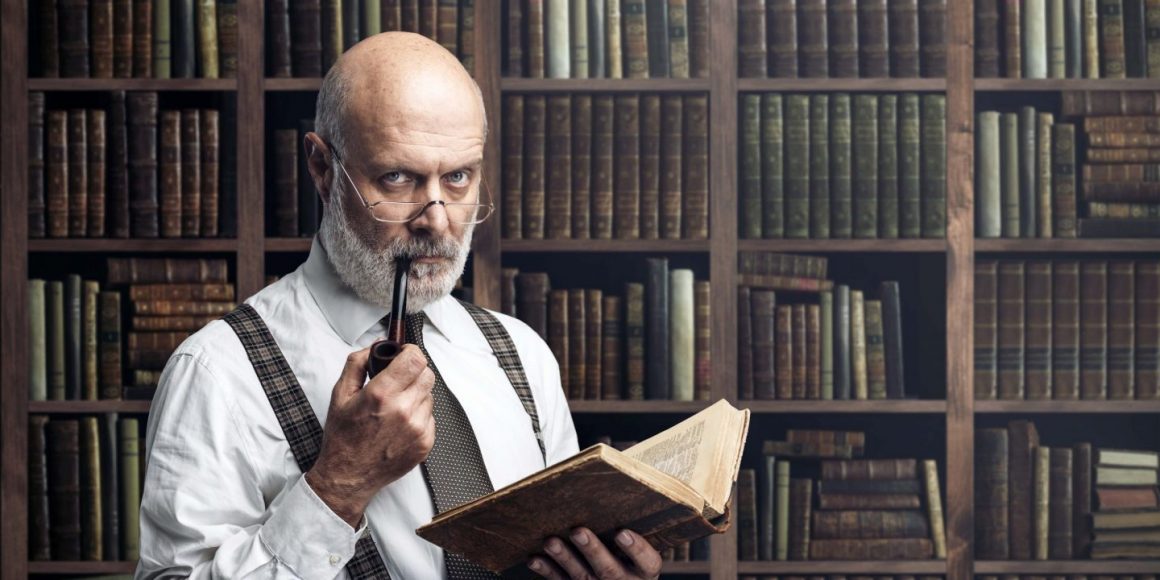Zwar lehrt eine Mischna (Sprüche der Väter 4,7), dass man die Tora nicht zu einem Werkzeug der Bereicherung machen darf, aber dennoch hat man in Babylonien einem Talmid Chacham, einem Toragelehrten, im Geschäftsleben einige Sonderrechte zugebilligt.
Ware So durften zum Beispiel Gewürzhändler in einer fremden Stadt ihre Ware im Umherziehen feilbieten, nicht aber einen Laden öffnen. War der Verkäufer jedoch ein Talmid Chacham, so war ihm dies erlaubt.
Der Talmud (Baba Batra 22a) fragt nach dem Grund der Bevorzugung und antwortet: »Toragelehrte könnten durch das Umherziehen von ihrem Studium abgehalten werden.«
Dörrfeigen Hat ein Händler einen Vorteil davon, dass er ein Talmid Chacham ist, dann muss es einen Weg zum Erwerb dieses Ranges geben. Von einem solchen Qualifikationsprozess handelt die folgende Geschichte (Baba Batra 22a): Einst brachte Raw Dimi aus Nehardea einen Kahn mit Dörrfeigen nach Pumbedita. Der gelehrte Mann wollte seine Ware auf dem Markt verkaufen und die Privilegien in Anspruch nehmen, die einem Talmid Chacham zustehen. Da sprach der Exilarch, der Führer der jüdischen Gemeinde, zu Raba, dem Schulhaupt: »Geh hin und sieh nach! Ist er ein Gelehrter, so halte für ihn den Markt frei.«
Was bedeutet »den Markt freihalten«? Der Talmudübersetzer Lazarus Goldschmidt (1871−1950) erklärt: »Man erteilt ihm das Recht zum alleinigen Verkauf dieser Waren.«
Aus irgendeinem Grund delegierte Raba die Aufgabe an seinen Schüler Raw Ada Bar Abba. »Da ging Raw Ada Bar Abba hin und richtete an Raw Dimi folgende Frage: Wie ist die Halacha, wenn ein Elefant einen Weidenkorb verschlungen und ihn durch den After ausgeworfen hat?«
frage Diese bizarre Frage – ob der Korb immer noch als Gefäß gilt und levitisch verunreinigungsfähig bleibt oder als Kot anzusehen ist − wird, das sollte man wissen, im Traktat Menachot (69a) erörtert – und nicht entschieden. Rabbiner Yonatan Feintuch von der Bar-Ilan-Universität meint, Raw Ada Bar Abba habe die ausgefallene Frage mit der Absicht gestellt, dass Raw Dimi die Prüfung nicht bestehen soll. Man kann ihn daher als einen unfairen Prüfer bezeichnen. Und wie erwartet, konnte Raw Dimi die Prüfungsfrage nicht beantworten.
Offenbar hatte sich Raw Ada Bar Abba dem Prüfling nicht vorgestellt. Denn Raw Dimi fragte ihn: »›Ist der Meister nicht Raba?‹ – Da gab ihm Raw Ada Bar Abba mit seiner Sandale einen Klaps und sagte: Von mir bis Raba ist es sehr weit; jedenfalls kann ich dein Lehrer sein: Raba ist der Lehrer deines Lehrers!«
Der Schlag mit der Sandale zeigt, dass Raw Ada Bar Abba den Kandidaten nicht respektvoll behandelte; in seinen Worten kam Hochmut zum Vorschein. Wegen der nichtbestandenen Prüfung gab man Raw Dimi den Markt nicht frei, und er erlitt schweren finanziellen Schaden.
Beschwerde Was tat der abgekanzelte Kaufmann? Raw Dimi beschwerte sich bei Raw Josef, dem Leiter der Akademie in Pumbedita. Dieser zeigte Verständnis und sagte dem gelehrten Dörrfeigenverkäufer, dass die ihm widerfahrene Kränkung nicht ungesühnt bleiben werde. Unsere Geschichte endet tragisch: »Da kehrte Raw Ada Bar Abbas Seele zur Ruhe ein.«
Sein plötzlicher Tod beschäftigte mehrere Amoräer: »Raw Josef sagte: Ich habe seine Bestrafung veranlasst, denn ich habe ihm geflucht. Raw Dimi sagte: Ich habe seine Bestrafung veranlasst, denn durch ihn habe ich Verlust an meinen Dörrfeigen erlitten.« Drei weitere Gelehrte meinten ebenfalls, sie hätten Raw Ada Bar Abbas Bestrafung veranlasst.
Die Tossafot kommentieren, jeder der fünf Amoräer habe seine Mitwirkung an Raw Ada Bar Abbas Bestrafung bedauert. Denn es heißt (Schabbat 149b): »Einen, durch den sein Nächster bestraft worden ist, lässt man nicht in den Kreis des Heiligen, gelobt sei Er.«
Prüfungen, die ein Kandidat zu bestehen hat, kennen wir aus den verschiedensten Lebensbereichen. Examen sind von der Sache her, um die es jeweils geht, leicht zu rechtfertigen. Der oben besprochene talmudische Text führt uns die Notwendigkeit einer Ethik des Prüfens vor Augen.