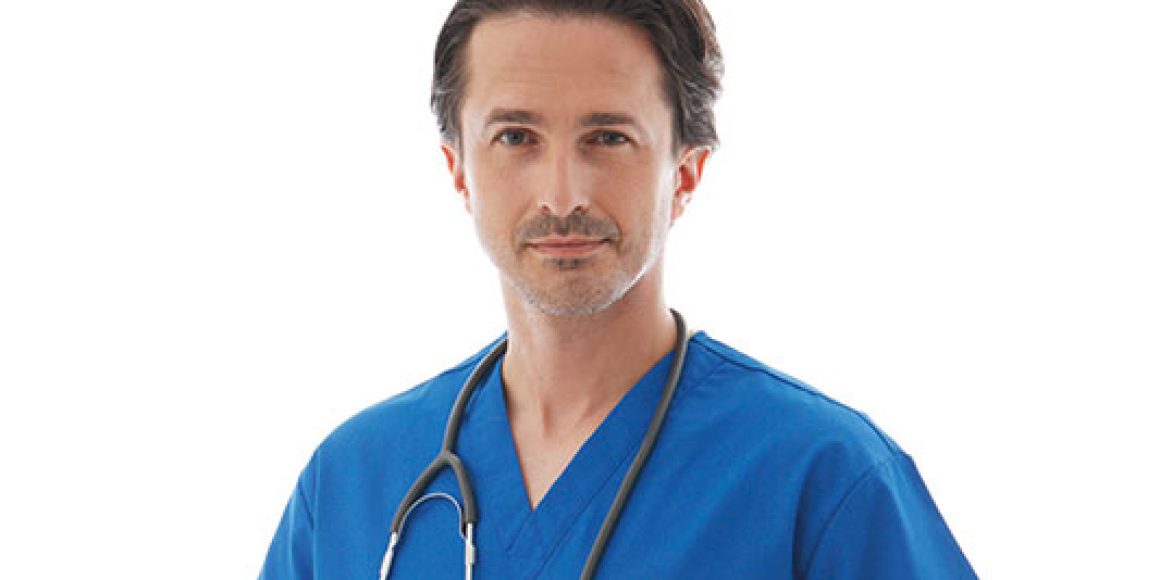Eine optimale medizinische Versorgung war schon in der Antike wichtig. Einen Hinweis darauf finden wir im Talmud, Sanhedrin 17b. Dort steht, ein Schriftgelehrter dürfe nicht in einer Stadt wohnen, in der es keinen Arzt gibt.
An anderer Stelle heißt es: »Wohne nicht in einer Stadt, deren Vorsteher ein Arzt ist« (Pessachim 113a). Was ist der Grund für diese merkwürdige Warnung? Rabbi Schmuel ben Meir, der Talmudkommentator Raschbam (1085–1158), ein Enkel Raschis, erklärt: weil der Arzt mit medizinischen Dingen beschäftigt ist und sich daher nicht mit Stadtangelegenheiten befassen kann.
schadensrecht Erwähnenswert ist eine Vorschrift aus dem talmudischen Schadensrecht: »Wenn der Schädiger zum Verletzten sagt: ›Ich will einen unentgeltlichen Arzt holen‹, so kann der Verletzte ihm erwidern: ›Ein Arzt für nichts ist nichts wert‹« (Baba Kamma 85a). Der Verletzte hat Anspruch auf einen kompetenten Arzt und kann daher einen Mediziner ablehnen, von dem er Grund hat anzunehmen, dass er nicht zu den guten zählt.
In der Reihe der sachlichen Aussagen über Ärzte scheint folgende Feststellung aus der letzten Mischna im Traktat Kidduschin (4,14) eine Ausnahme zu sein: »Der beste der Ärzte ist auf dem Weg zur Hölle!«
Zwar haben Forscher aufgrund alter Handschriften behauptet, dass es sich bei diesem Satz um eine spätere Hinzufügung zur Mischna handelt, aber da der erwähnte Spruch in unsere gedruckten Talmudausgaben gelangt ist (Kidduschin 82a), sind wir gezwungen, seinen Sinn zu ergründen.
wohltäter Ärzte leisten für ihre Patienten einen äußerst wertvollen Dienst – warum werden diese Wohltäter mit der schrecklichen Hölle in Verbindung gebracht? Der bekannte Talmudkommentator Raschi (1040–1105) gibt mehrere Erklärungen, von denen ich hier nur zwei anführe. Die eine: Manchmal unterlaufen einem Arzt Behandlungsfehler, die zum Tod des Patienten führen. Die andere: Der Arzt könnte einen Armen heilen, und er tut dies nicht. Unterlassene Hilfeleistung aus finanziellen Gründen führt also in die Hölle.
Rabbiner Schmuel Elieser Edels, bekannt als der Maharscha (1555–1631), gibt der Wendung »der beste der Ärzte« eine interessante Deutung. Gemeint sei nicht jeder Mediziner, sondern nur ein solcher, der meint, er wisse alles besser als seine Kollegen, und sich deshalb nicht mit ihnen berät. Kritisiert wird in der Mischna also nicht jeder praktizierende Arzt, sondern nur derjenige, der hochmütig ist und sich als beratungsresistent erweist.
Der italienische Arzt und Rabbiner Jacob Ben Yizhak Zahalon (1630–1693) erklärt den Satz in seinem Werk Otzar Hachajim wie folgt: Es wäre gut und empfehlenswert, wenn jeder Arzt – sogar der beste – sowohl bei Diagnosestellung als auch bei der Festlegung von Therapiemaßnahmen an die Hölle denkt, damit er zu keiner Zeit nachlässig handelt.
entscheidungen Ähnlich habe Rabbi Jonathan dem Richter geraten, sich stets vorzustellen, es sei die Hölle unter ihm offen (Sanhedrin 7a). Folgen von medizinischen und juristischen Entscheidungen sind sorgfältig zu bedenken. Jede Nachlässigkeit zieht negative Konsequenzen nach sich, die den unvorsichtigen Täter direkt in die Hölle führen können.
Der Talmud will den Beruf des Arztes keineswegs in ein negatives Licht rücken – im Gegenteil: Die Arbeit der Ärzte wird als eine sehr wichtige Mizwa angesehen, und es ist kein Zufall, dass so bedeutende Toralehrer wie Maimonides (1135–1204) und Nachmanides (1194–1270) als Ärzte wirkten. Man kann den prägnanten Satz »Der beste der Ärzte geht zur Hölle« leicht als generelle Ablehnung der Mediziner missverstehen. Doch er will lediglich auf die Gefahren aufmerksam machen, die jeder Arzt kennen sollte, um sie möglichst zu vermeiden.