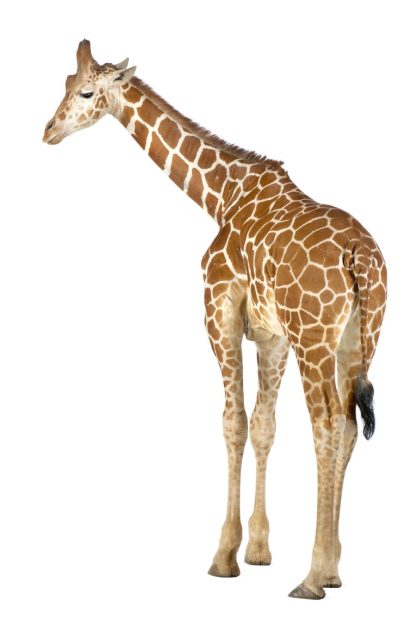Die Tierwelt ist ein Wunderwerk der gʼttlichen Schöpfung. Eines der faszinierenden Tiere, das mit seiner Pracht und Eleganz hervorsticht, ist zweifellos die Giraffe. Giraffen sind die höchsten Tiere, die auf dem Land und nicht im Wasser leben. Aufgrund ihres majestätischen Auftretens war es in der Antike und im Mittelalter unter Königen üblich, Giraffen zu importieren und zu verschenken oder dem Volk zur Schau zu stellen.
So soll schon Julius Cäsar 46 v.d.Z. Anweisung gegeben haben, eine Giraffe nach Rom zu bringen. Am 23. Oktober 1826 betrat zum ersten Mal eine Giraffe französischen Boden. Sie war ein exotisches Geschenk des ägyptischen Vizekönigs Muhammad Ali Pascha (1769–1849) für den französischen König Charles X.
hype Die Ankunft des großen Tiers in Frankreich löste einen Giraffen-Hype aus (La mode à la girafe), der die Gastronomie, Mode, Kunst und Kultur des frühen 19. Jahrhunderts in Frankreich beeinflusste.
Nur zehn koschere Tiere werden ausdrücklich und mit Namen in der Tora erwähnt.
Doch sind Giraffen koschere Tiere? »Dies ist das Vieh, das ihr essen dürft: Ochse, Schaflamm und Ziegenlamm, Reh, Hirsch und Jachmur, Acko, Dischon, Teo und Zemer. Und jedes Vieh, das einen Huf bildet und ihn ganz durchspaltet zu zwei Hufen und zugleich wiederkäuend ist unter dem Viehe, das dürft ihr essen«, so heißt es im 5. Buch Mose 14, 4–6.
LISTE Die Tora schreibt also vor, dass ein Tier nur dann koscher ist, wenn es über gespaltene Hufe verfügt und Wiederkäuer ist. Maimonides, der Rambam (1135–1204), legte in seinem Gesetzeskodex Mischne Tora (Maachalot Assurot 1,8) fest, dass nur die zehn Tiere, die in der Tora erwähnt werden, zum Verzehr erlaubt sind. Giraffen haben zwar gespaltene Hufe und sind Wiederkäufer, aber die entscheidende Frage ist, ob Giraffen in der Tora erwähnt werden.
Laut manchen Gelehrten werden Giraffen in der Tat in der Tora erwähnt. Saadia Gaon (882–942) übersetzt das hebräische Wort »Zemer« mit »Al-saraffa«, die arabische Bezeichnung für Giraffe. Auch der Raschbaz, Rabbiner Schimschon Ben Zemach Duran (1361–1444), scheint eine Giraffe zu beschreiben und bestätigt, dass es sich dabei um das biblische Tier »Zemer« handelt. Rabbiner Joseph Schwarz (1804–1865) zitiert in seinem umfassenden Werk Tevuat HaAretz die Übersetzung von Rabbiner Saadia Gaon und bestätigt seine Richtigkeit anhand seiner Erfahrung, als er 1854 eine lebende Giraffe aus Ägypten zu sehen bekam und sie auf die koscheren Merkmale überprüfen konnte.
Vor etwa 20 Jahren wurde dann an der Bar-Ilan-Universität unter Aufsicht des israelischen Oberrabbinats eine Giraffe obduziert. Dabei wurden die koscheren Merkmale bestätigt.
MISCHKAN Laut einer anderen Meinung handelte es sich bei dem sagenumwobenen Tier »Tachasch« um eine Giraffe. Der Tachasch wird als sehr schönes Tier beschrieben, dessen Fell beim Bau des Mischkans, des Stiftszelts, verwendet wurde.
Es scheint also durchaus so, dass Giraffen koscher sind und zum Verzehr erlaubt wären. Aber es gibt eventuell eine halachische Hürde, die überwunden werden muss.
Bei der Frage, welche Vögel koscher sind, legt Rabbiner Mosche Isserles (1530–1572) in seinem Kommentar zum Schulchan Aruch fest, dass wir uns nicht auf die biblischen Namen und die koscheren Merkmale allein verlassen können und nur das essen dürfen, wofür es eine Masoret, eine Überlieferung vorheriger Generationen, gibt. Deswegen essen manche Gelehrten keine Truthähne, weil sie für deren Verzehr keine Überlieferung kennen.
Die Frage ist aber, ob dasselbe auch für Vieh gilt. Diesbezüglich besteht eine Meinungsverschiedenheit zwischen Rabbiner Awraham Danzig (1748–1820), Autor von Chochmat Adam, und Rabbiner Yosef Teumin (1727–1792), Autor des umfangreichen Kommentars zum Schulchan Aruch, Pri Megadim, beide etablierte halachische Persönlichkeiten.
Wir essen keine Giraffen, obwohl sehr vieles für ihren Kaschrut-Status spricht.
Obwohl Rabbiner Awraham Yeschajahu Karelitz (1878–1953), bekannt als »Chazon Ish«), die größte halachische Autorität des 20. Jahrhunderts, der Meinung von Rabbiner Danzig folgt und wir trotz der koscheren Merkmale auch eine Überlieferung benötigen, um Giraffen für koscher zu erklären, gibt es Rabbiner, die argumentieren, dass die genaue Identifizierung der Giraffe durch Rabbiner Saada Gaon dafür ausreichend war.
Doch wenn Giraffen koschere Tiere sind, warum werden sie dann nicht gegessen? Viele meinen, es habe damit zu tun, dass wir nicht wissen, an welcher Stelle am (sehr langen) Hals das Schlachtmesser angesetzt werden müsste, um eine Giraffe der Halacha entsprechend zu schlachten. Das ist jedoch ein Irrtum, weil es gar keine bestimmte Stelle dafür geben muss, sondern der gesamte Hals für das Schlachten geeignet ist (Schulchan Aruch, Jore Dea, Siman 20).
SPEISEKARTE Dass Giraffen nicht auf jüdischen Speisekarten stehen, liegt wahrscheinlich daran, dass sie über viele Jahrhunderte hinweg in der Nähe der Wohnorte von Juden nicht vorkamen – oder es hat den Grund, dass Giraffenfleisch zu zäh ist.
Seit 2016 befinden sich die Giraffen ohnehin auf der Roten Liste gefährdeter Arten. Um zusätzlich auf die Gefährdung dieser Tiere aufmerksam zu machen, hat die Giraffe Conservation Foundation (GCF) den 21. Juni zum »Welttag der Giraffe« erklärt. Wir Juden tun also gut daran, auch in Zukunft auf den Verzehr von Giraffenfleisch zu verzichten.
Der Autor ist Rabbiner und Dozent am Rabbinerseminar zu Berlin.