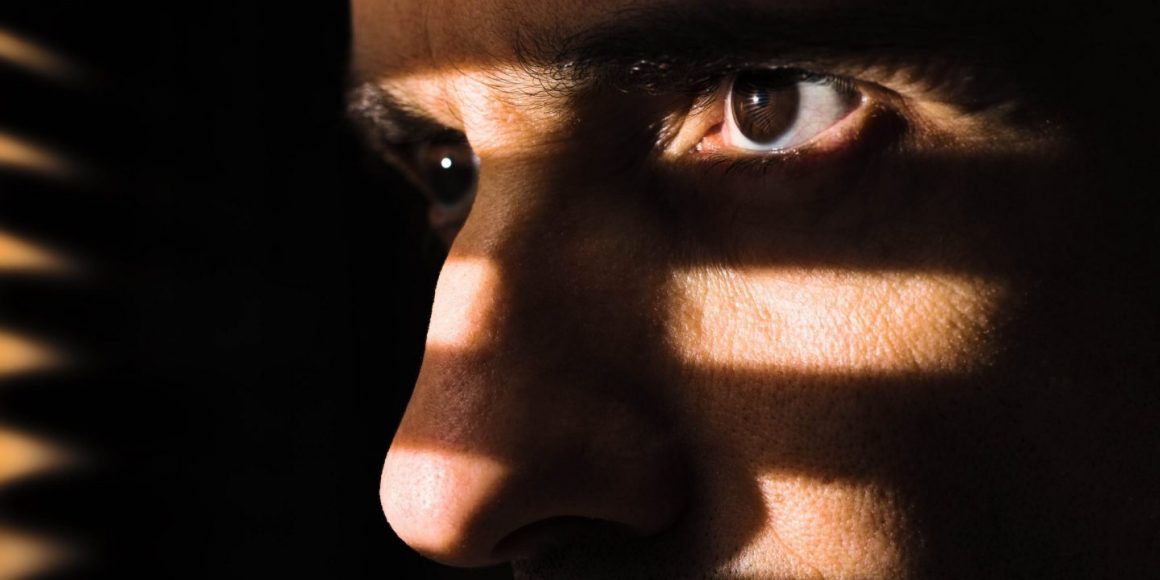Die Israeliten standen kurz vor dem Einzug ins verheißene Land. Doch vorher wollten sie Spione aussenden, um das Land auszukundschaften. Dass dies ein legitimes Anliegen war, belegt die Tatsache, dass Jehoschua diesen Vorgang 40 Jahre später erfolgreich wiederholte und G’tt dies auch akzeptierte.
In unserem Wochenabschnitt kehren die Spione mit einem vernichtenden Urteil zurück. Sie sagen, das Volk Israel würde in einem Krieg mit den Einwohnern des Landes sterben.
Das Volk bekommt es mit der Angst zu tun, ist entmutigt – und resigniert.
Die Spione stellen die Sinnhaftigkeit des Exodus infrage, sehen ihren Tod vor Augen, machen Mosche und G’tt Vorwürfe. Als Konsequenz stirbt diese ganze Generation in der Wüste, und der Einzug ins Gelobte Land muss um 40 Jahre verschoben werden.
KLAGEN Seit wann ist es eine Sünde, Angst zu haben? Warum wurden die Israeliten wegen ihres Klagens und Jammerns so hart bestraft? Gejammert haben sie öfter, ohne so schwerwiegende Konsequenzen tragen zu müssen. Was macht dieses Fehlverhalten so einzigartig?
An dieser Stelle gilt es zu differenzieren, was die Sünde der Spione und das Fehlverhalten des Volkes war. Es gibt verschiedene Versuche, dies zu erklären.
Dem Volk wird angelastet, angesichts dessen, welche offenen Wunder es im Zusammenhang mit dem Auszug aus Ägypten bereits erlebt hatte, hätte es mehr auf G’tt vertrauen müssen und demzufolge gar keine Spione entsenden dürfen. Ferner hätte es nach dem Bericht der Spione das Vertrauen in G’tt nicht verlieren dürfen.
Die Spione waren allesamt Anführer ihrer eigenen Stämme. Darauf beruht ein Erklärungsansatz, wonach sie Angst um ihre Position hatten, denn sie wussten nicht, wie die Stämme nach dem Einzug ins Land hierarchisch strukturiert werden würden. Deshalb berichteten sie negativ über das Land.
STATUS Doch diese niedrigen Beweggründe sind schwer in Einklang zu bringen mit dem religiösen Status dieser Leute. Dieser Widerspruch führte den Lubawitscher Rebben, Rabbi Menachen Mendel Schneerson (1902–1992), zu einem anderen Erklärungsansatz: Die Spione hatten Angst vor dem erfolgreichen Einzug und der Integration ins Land.
Bisher, in der Wüste, waren die Israeliten dem Ewigen extrem nah gewesen. Sie bekamen ihr Essen vom Himmel, tranken Wasser aus einer wundersamen Quelle, waren umhüllt von einer g’ttlichen Wolke, lagerten um das Stiftszelt und waren dadurch stets in Kontakt mit dem G’ttlichen.
Wäre das Volk ins Land eingewandert, hätte sich manches verändert: Man hätte eine Armee gebraucht und in Kriegen kämpfen müssen. Eine Wirtschaft wäre aufzubauen, und man hätte sich wegen der Ernte um das Wetter gesorgt. Soziale und politische Fragestellungen hätten behandelt werden müssen, um eine funktionierende Gesellschaft zu errichten.
Die Spione befürchteten, dass all diese Dinge zu einer Ablenkung der geistigen Entwicklung hätten führen können oder zumindest eine Distanzierung des G’ttlichen zur Folge gehabt hätten.
DENKFEHLER Sie waren nicht besorgt wegen der physischen Bedrohung durch die bevorstehenden Kriege, sondern sie hatten Angst vor der spirituellen Bedrohung durch eine erfolgreiche Eroberung. Der Lubawitscher Rebbe führt aus, dies sei ein Denkfehler der Spione gewesen.
Das Judentum lasse sich nicht im Elfenbeinturm, im Rückzug oder wie in unserem Fall in der Wüste am intensivsten leben, sondern es gehe darum, das Judentum in den Alltag zu integrieren, in die Gestaltung einer Gesellschaft mit g’ttgewollten Werten und in die Ausübung scheinbar profaner, irdischer Angelegenheiten.
Dieser Ansatz erklärt nur die Sünde der Spione. Doch worin bestand die Sünde des Volkes? Vielleicht lässt sich ein Erklärungsansatz herleiten, der auf den oben beschriebenen Interpretationen beruht.
Aufgrund der 210 Jahre dauernden Versklavung in Ägypten, dem Auszug und den zahlreichen Wundern war im Volk eine Abhängigkeit von Mosche und den Stammesführern entstanden. Die Israeliten mussten sich nicht selbst anstrengen, sie wurden mit allem Notwendigen versorgt, sie mussten nichts reflektieren oder sich kritisch hinterfragen. Eigenständiges Denken war nicht nötig, die Verantwortung konnte abgegeben werden.
Selbstständigkeit Doch dies sind wichtige Eigenschaften, um einen Grad an Selbstständigkeit und Unabhängigkeit zu erlangen – was unabdingbar gewesen wäre, um als Volk im Gelobten Land erfolgreich zu bestehen.
Nach dem negativen Urteil der Spione hätte das Volk, aufgrund seiner eigenen Erfahrungen mit den Wundern, die Aussage ihre Anführer hinterfragen sollen.
Es wäre an der Zeit gewesen, Abschied zu nehmen vom blinden Gehorsam. Die Israeliten hätten ihre Verantwortung wahrnehmen und selbstständig handeln sollen. Man hätte erwarten können, dass sie aufgrund ihrer Erlebnisse mündig geworden und in der Lage sind, selbst eine Entscheidung zu treffen. Doch sie verharrten in alten Mustern. Das zeigt, dass sie für den Einzug ins Land noch nicht reif waren.
Aus alten bequemeren Verhaltensmustern auszubrechen, ist eine Lebensaufgabe für jeden, vor allem, wenn es darum geht, selbstständig zu werden. Es ist natürlich einfacher, es jemand anderem zu überlassen, unangenehme Entscheidungen zu fällen. Es ist praktischer, die Verantwortung abzugeben. Zwar kann ich meinen Partner, meine Eltern, meinen Lehrer, meinen Chef, Arzt, Rabbiner oder meinen besten Freund um Rat fragen, doch eine persönliche Entscheidung können sie nicht für mich treffen.
Keine Entscheidung zu treffen, ist auch eine Entscheidung. Doch wie wir aus diesem Wochenabschnitt entnehmen, war diese Entscheidung die falsche!
Der Autor ist Rabbiner der Jüdischen Gemeinde Osnabrück und Psychologe.
INHALT
Mit G’ttes Erlaubnis sendet Mosche zwölf Männer in das Land Kanaan, um es auszukundschaften. Von jedem Stamm ist einer dabei. Zehn kehren mit einer erschreckenden Schilderung zurück: Man könne das Land niemals erobern, denn es werde von Riesen bewohnt. Lediglich Jehoschua bin Nun und Kalev ben Jefune beschreiben Kanaan positiv und erinnern daran, dass der Ewige den Israeliten helfen werde. Doch das Volk schenkt dem Bericht der Zehn mehr Glauben und ängstigt sich. Darüber wird G’tt zornig und will das Volk an Ort und Stelle auslöschen. Doch Mosche kann erwirken, dass G’ttes Strafe milder ausfällt.
4. Buch Mose 13,1 – 15,41