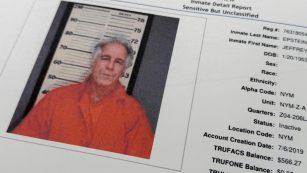Leichentücher mit Namen und Lebensdaten von Opfern nationalsozialistischer Gewalttaten, deren Körper in die Anatomie gebracht wurden: Sie markieren den Eingang zur Ausstellung »Entgrenzte Anatomie. Eine Tübinger Wissenschaft und der Nationalsozialismus«, die bis Ende September in der Schausammlung der Alten Anatomie in Tübingen zu sehen ist.
Bewusst sei der historische Ort, die Alte Anatomie der Universität Tübingen, für diese Ausstellung ausgewählt worden, da es dort bis heute keinen Hinweis auf die NS-Opfer gebe, deren Leichen dort für Lehre und Forschung verwertet wurden, sagt Benigna Schönhagen vom Projekt Gräberfeld X. Diese »Leerstelle« habe den Anlass für ein mehrsemestriges Lehrforschungsprojekt gegeben, berichtet Schönhagen, die auch eine der vier Kuratoren der Ausstellung ist.
Kriegsgefangene Zwischen 1933 und 1945 wurden die Leichen von rund 1000 Menschen für Lehr- und Forschungszwecke an die Tübinger Anatomie geliefert. Mehr als die Hälfte von ihnen wurden Opfer nationalsozialistischer Gewalttaten, waren zum Beispiel Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, Insassen von Arbeitshäusern oder Heil- und Pflegeanstalten, zum Tod Verurteilte.
Auch wenn 1990 alle menschlichen Präparate aus der NS-Zeit entfernt wurden, berichten die akribisch geführten Namenslisten in den Leichenbüchern der Anatomie sowie Texte und Fotografien von dem Unrecht. Die Einträge in den Büchern zeigen: Während Wissenschaftler zuvor »Sozialleichen« wie verstorbene Obdachlose, Hingerichtete und Totgeborene nur in geringer Zahl sezieren konnten, gehörte mit Kriegsbeginn das Problem der Leichenbeschaffung der Vergangenheit an.
Deutliche Züge einer rassistischen Anatomie traten auf, in der Menschen, die als minderwertig eingestuft wurden, in die Tübinger Anatomie kamen, etwa 156 sowjetische Kriegsgefangene, die unter anderem durch Zwangsarbeit starben.
Auch als »Volksschädlinge« Hingerichtete wurden nach Tübingen gebracht, zeigen die Namen im Leichenbuch - darunter die Leichen von Widerstandskämpfern der Lechleiter-Gruppe, wie Rudolf Langendorf und Anton Kurz. Die Anatomen zogen bedenkenlos diese Körper für ihre Forschung und Lehre heran, es schien keine ethischen Grenzen mehr zu geben.
Gewaltherrschaft Insgesamt 53 Studierende der Medizin und der Geschichtswissenschaft haben die Inhalte der Ausstellung erarbeitet. Sie haben sich mit der Entwicklung der Tübinger Anatomie vor, während und nach der NS-Gewaltherrschaft und mit den Fragen des Umgangs mit menschlichen Überresten (»Human Remains«) befasst.
Denn auch wenn es keine menschlichen Überreste mehr aus der NS-Zeit gibt, stelle sich die Frage, wie man mit Humanpräparaten umgeht, die aus Zeiten stammen, in der Menschen nicht um Erlaubnis gefragt wurden, ob nach ihrem Tod an ihren Körpern geforscht werden darf, sagte Stefan Wannenwetsch vom Projekt Gräberfeld X. Zur anatomischen Schausammlung gehören beispielsweise immer noch Kinderskelette, deren Umrisse schemenhaft hinter einem milchigen Transparentpapier versteckt sind.
Am Ende der Ausstellung kommen die Besucher wieder an den Leichentüchern vorbei und sind eingeladen, die Namen und Lebensdaten der Menschen, die auf den Tüchern stehen, nachzusticken. Dies solle dazu beitragen, dass Besucher von der Biografie der Toten erfahren, diese würdigen und die Verstorbenen in Erinnerung behalten, erklärt Stephan Potengowski, der die Gestaltung der Ausstellung entwickelt hat. Denn: »Jeder Name war ein Leben.«
Die Ausstellung wurde mit einem Vortrag von Götz Aly eröffnet, der für seine Forschung zu den NS-Medizin-Verbrechen bekannt ist. Weitere Vorträge von Expertinnen und Experten der NS-Medizingeschichte begleiten die Ausstellung. epd