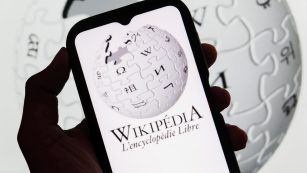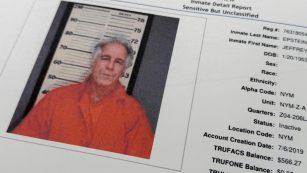Ende Juli wurde es beim Londoner Auktionshaus »Sotheby’s« für knapp sechs Millionen Euro versteigert: das Raubkunstbild »Ansicht des Zwingergrabens in Dresden« des venezianischen Malers Canaletto. Zuvor hatten die Nachfahren des jüdischen Hamburger Kaufmanns Max Emden 15 Jahre lang um die Rückgabe des Bildes und eines weiteren Canaletto-Werkes, »Die Karlskirche von Wien«, gekämpft.
Dass sich im März 2019 die »Beratende Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts, insbesondere aus jüdischem Besitz« schließlich für die Rückgabe der Bilder ausgesprochen hatte, könnte als wegweisend für den Umgang mit Raubkunst gelten.
Auch wenn die Umstände der Rückgabe »eher nüchtern« gewesen seien, sagt Max Emdens Urenkelin Maeva Emden, nachdem sie vor wenigen Monaten im Kunstdepot des Bundesfinanzministeriums in Berlin-Weißensee die beiden Gemälde sehen konnte, die einst ihrem Urgroßvater gehörten. Es sei schön gewesen, die Bilder zurückzubekommen, sagt die Erbin. Doch sie hätte »gerne eine offizielle Übergabe gehabt«, meint die Hamburgerin. »Ich finde, die Kommunikation ist nicht gut gelaufen.«
15 Jahre dauerte es, bis die Familie die Bilder zurückbekam.
15 Jahre dauerte es, bis die Familie die Bilder zurückbekam – ein mühevoller und beschwerlicher Weg. Der Fall Emden sei ein gutes Beispiel dafür, dass es Eigentümer gab, die ihre Bilder unter widrigen Umständen und häufig auch unter Wert verkaufen mussten, um entweder ihre Flucht oder ihren Lebensunterhalt im Exil zu bestreiten, sagt Rechtsanwalt Markus Stötzel. Dieser Aspekt werde in den Restitutionen nach wie vor viel zu wenig berücksichtigt. Auch deshalb sei der Fall Emden so wichtig.
MÄZEN In den 20er-Jahren investierte Max Emden, ein erfolgreicher wohlhabender Kaufmann, der mehrere Warenhäuser besaß, darunter das Berliner »KaDeWe« und das »Oberpollinger« in München, sein Geld in Immobilien und Kunst. Als Mäzen und Kunstliebhaber unterstützte er auch mehrere Hamburger Institutionen wie die Universität und die Kunsthalle. Außerdem spendete er der Stadt einen Poloklub.
1927 kaufte Emden, der zum Christentum konvertiert war, die Schweizer Insel Brissago im Lago Maggiore. Hier ließ er sich dauerhaft nieder und nahm 1934 die Schweizer Staatsbürgerschaft an. Trotzdem betrachteten ihn die Nazis als Jude und beschlagnahmten seine Besitztümer. Emdens Sohn, Hans Erich, wurde die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen. Er rettete sich nach Chile. Der Dokumentarfilm Leben ist auch eine Kunst, der 2019 in die Kinos kam, erzählt die Familiengeschichte.
Die beiden Gemälde nahm Max Emden mit in die Schweiz. Ende der 30er-Jahre verkaufte er sie für je 20.000 Franken über die jüdische Kunsthändlerin Anna Caspari an Karl Haberstock – dieser sollte als Hitlers Sonderbeauftragter für das geplante Führermuseum Linz Kunstwerke zusammentragen.
Nach dem Krieg fanden US-Soldaten die Bilder im Salzbergwerk Alt-Aussee in der Steiermark. Mit Gründung der Bundesrepublik Deutschland gingen sie in Bundesvermögen über und landeten so im Kunstdepot des Bundesfinanzministeriums. Von 1961 bis 2005 hing der »Zwingergraben« in der Villa Hammerschmidt, dem Bonner Amtssitz des Bundespräsidenten.
Noch 2500 Werke aus der Kunstsammlung der Bundesregierung stehen unter Raubkunstverdacht.
Als Rechtsanwalt Markus Stötzel Bundespräsident Köhler auf die Vorgeschichte des Bildes aufmerksam macht, lässt dieser es umgehend abhängen. Nach der Wiedereröffnung des Dresdner Militärhistorischen Museums 2011 war es dort zu besichtigen.
Im Fall von Max Emden sei »von keinem verfolgungsbedingten Verkauf auszugehen, weil Emden in der Schweiz wohnte«, hieß es lange als Begründung seitens der zuständigen Behörden. Ein Gutachten der Familie jedoch konstatierte, dass Emden am Ende seines Lebens nahezu mittellos war und verkaufen musste, um seinen Lebensunterhalt zu sichern.
NOTLAGE Nach zähem Ringen einigten sich beide Seiten, den Fall an die »Beratende Kommission« weiterzugeben. Diese entschied im Frühjahr 2019 zugunsten der Familie und bestätigte in ihrer Begründung, dass der Verkauf aufgrund der »durch die nationalsozialistische Verfolgung unmittelbar ausgelöste wirtschaftliche Notlage Max Emdens und des damit verfolgungsbedingten Vermögensverlustes« erfolgt war.
1998 hatte sich der Bund mit der Unterzeichnung der »Washingtoner Erklärung« verpflichtet, die Eigentümer geraubter Kunst ausfindig zu machen und die Werke den Erben zurückzugeben. Erst Anfang 2019 war bekannt geworden, dass noch immer 2500 Werke aus der Kunstsammlung der Bundesregierung im Verdacht stehen, während der Zeit des Nationalsozialismus ihren jüdischen Besitzern geraubt worden zu sein.
Stötzel hofft nun, dass die Empfehlung der Kommission im Fall Emden auch für andere Verfahren beispielhaft sein könnte. So müsse etwa beim Tauziehen um Franz Marcs Bild »Füchse« zwischen den Erben und der Stadt Düsseldorf davon ausgegangen werden, dass der ursprüngliche Besitzer Kurt Grawi aus einer Notlage heraus verkauft habe.
Maeva Emden hätte die beiden Canalettos gerne der Hamburger Kunsthalle zur Verfügung gestellt, um an dem Ort, den ihr Urgroßvater einst förderte, an ihn zu erinnern. Doch die Mehrheit der Familie, die in Chile und Hamburg lebt, entschied sich zum Verkauf, auch um die jahrelang angehäuften Rechtsstreitkosten zu begleichen. Und der Kampf gehe weiter, so die Urenkelin. Denn weitere Bilder, die einmal ihrem Urgroßvater gehörten, hängen noch in Schweizer, australischen und amerikanischen Museen.