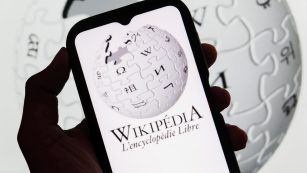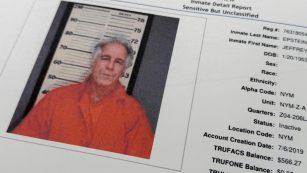Junge Israelis, kaum 20 Jahre alt, die in grauen Uniformen vor dem Palast ihres Präsidenten die deutsche Nationalhymne spielen. Und gleich darauf die Hatikwa. Hinter ihnen ein Strauß schwarz-rot-goldener und blau-weißer Fahnen. So klingen, so sehen sie aus, die Beziehungen zwischen Deutschland und dem jüdischen Staat Ende November 2010. Ein besonderes Verhältnis, trotz aller diplomatischen Routine, die sich in den vergangenen Nachkriegsjahrzehnten entwickelt hat. Auch Christian Wulffs erster Israel-Besuch als neuer Bundespräsident ist alles andere als alltäglich oder »normal«, auch wenn Schimon Peres ihn an diesem Sonntagvormittag in seiner Jerusalemer Residenz einen »alten Freund des jüdischen Staates« nennt.
Vieles zwischen Israel und Deutschland wirkt gegenwärtig, ja zukunftsorientiert. Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur – der Austausch zwischen beiden Staaten funktioniert. Es könnte also alles von einer gewissen Leichtigkeit sein. Aber da ist, da bleibt die Vergangenheit. Die Schoa. Dieses »unfassbare Verbrechen«. Das sind die Worte, die Wulff am Mittag ins Gästebuch von Yad Vashem schreiben wird. Verbunden mit einem klaren Bekenntnis zu Israels Sicherheit und Existenzrecht.
Versöhnungsarbeit Und da ist die Verantwortung der Deutschen. Auch sie bleibt, hat Bestand für die kommenden Generationen. Um das deutlich zu machen, ist Wulff nach Israel gekommen. Es geht um Versöhnungsarbeit. Deshalb hat er nicht nur die obligatorische Wirtschaftsdelegation aus Deutschland mitgebracht, sondern auch einige Jugendliche. Und seine 17-jährige Tochter Annalena, die in Osnabrück zur Schule geht. Mehr Symbolik geht kaum. Zeichen setzen und zuhören, das sind auch die beiden Aspekte, die im Vordergrund von Wulffs erstem Tag im Heiligen Land stehen.
Dafür nimmt sich der Bundespräsident Zeit, viel Zeit. Nach der Auftaktbegegnung mit Amtskollege Peres und einer Kranzniederlegung am Grab von Theodor Herzl geht es zur Holocaust-Gedenkstätte. Bald zwei Stunden lässt sich Wulff durch die Ausstellung des Museums führen. Vorbei an Vitrinen mit Dokumenten, Fotos und anderen Zeugnissen, die das Grauen der Schoa dokumentieren.
Gedenken Am Ende seines Rundgangs steht Wulff in der Halle der Erinnerung. Dort, wo eine immer brennende Flamme an die Millionen Opfer des Holocaust erinnert. Dort, wo alle Staatsgäste der Ermordeten gedenken. Dort, wo im steinernen Boden die Namen der großen Vernichtungslager zu lesen sind. Zu seiner Linken Schimon Peres, zu seiner Rechten Tochter Annalena. Wie ihr Vater hat die groß gewachsene junge Frau mit dem langen blonden Haar ihre Hände vor dem Oberkörper gefaltet. Und dann legen zwei der mitreisenden Jugendlichen einen Kranz nieder. Wulff tritt vor, richtet die Bänder, macht einen kurzen Schritt zurück und verharrt für eine Minute. Auch das ein Bekenntnis zum schlimmsten Kapitel der Geschichte. Und eines zu Israel, zum jüdischen Staat, an dessen Seite die Bundesrepublik steht, weiter stehen wird. Daran lässt der Chef von Schloss Bellevue keinen Zweifel. Die Vergangenheit, so lautet die Botschaft, kann nichts Vergängliches haben. Die Erinnerung an die Nazibarbarei zu bewahren: ein deutsches Anliegen.
Aber trotz Macht der Vergangenheit – Gegenwart und Zukunft fordern auch ihren Tribut. Das Jetzt und das Morgen lassen sich in dieser Krisenregion auf ein Kernproblem herunterbrechen: den Nahostkonflikt. Wulff weiß das. Doch er ist nicht nach Israel gekommen, um Ratschläge zu erteilen. Dem nach dem Krieg Geborenen geht es vielmehr darum, Vertrauen zu schaffen, er will erfahren, was Deutschlands Rolle sein könnte. Und er möchte die andere Seite hören. Am Dienstag geht es nach Bethlehem, ins palästinensische Autonomiegebiet. Dort trifft Wulff mit Präsident Mahmud Abbas zusammen. Die Vergangenheit wird in diesem Gespräch vermutlich nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Denn beim Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern steht vor allem eines auf dem Spiel: die Zukunft.