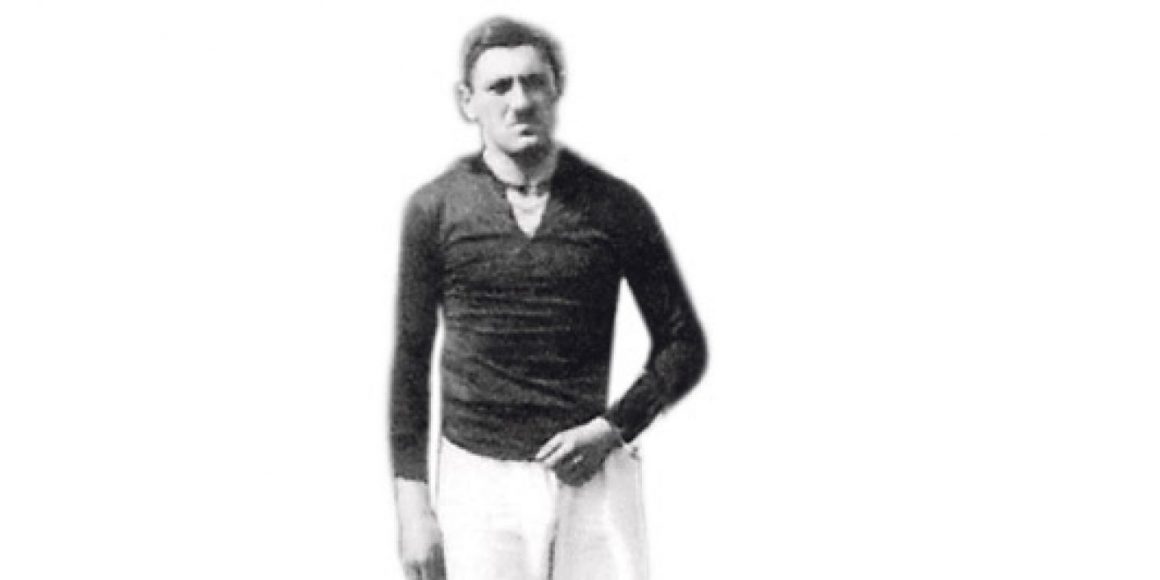Wenige Tage nach Beginn der Fußball-EM in Polen und der Ukraine wird eine Delegation des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) die KZ-Gedenkstätte Auschwitz besuchen. Die Spieler Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger werden dabei sein, auch Trainer Jogi Löw und Manager Oliver Bierhoff. Was der Nationalmannschaftsfußball mit Auschwitz zu tun hat, das zeigt die Geschichte von Julius Hirsch, von 1911 bis 1914 Nationalspieler, ermordet vermutlich 1943 in Auschwitz.
länderspiele »Dieser Linksaußen spielt jetzt immer«, hatte der englische Trainer William Townsley 1909 nach einer Partie des Karlsruher Fußball-Vereins gegen den Freiburger FC gesagt. Er meinte den 17 Jahre alten Julius Hirsch, der sein Debüt in der Ersten Mannschaft der Karlsruher mit einem Tor gekrönt hatte. Es war ein vielversprechender Auftakt. 1910 wurde Hirsch mit dem Karlsruher FV Deutscher Meister, 1914 mit der SpVgg Fürth. Mit der süddeutschen Auswahl gewann er den Kronprinzenpokal, war bei Olympia 1912 dabei und schoss in sieben Länderspielen vier Tore.
Julius Hirsch ist nicht nur einer der erfolgreichsten Spieler seiner Zeit gewesen, sondern auch einer der nur zwei jüdischen Spieler, die je für den DFB aufgelaufen sind. Der Autor Werner Skrentny hat nun eine Biografie über Julius Hirsch vorgelegt. Durch jahrelange Recherche in Archiven und Bibliotheken sowie Gesprächen mit den Nachkommen gelang es Skrentny, Hirschs Leben nahezu lückenlos zu dokumentieren: die sportlichen Erfolge, den Kriegsdienst von 1914 bis 1918, Berufstätigkeit und Familienleben in den 20er-Jahren, Ausgrenzung und Zwangsarbeit in der Nazizeit und schließlich 1943 die Deportation nach Auschwitz.
Bereits 1993 führte Skrentny ein Interview mit Hirschs Sohn Heinold. Bei der Arbeit zu einem früheren Buch hatte er in einer DFB-Chronik diesen Hinweis zu Hirsch gelesen: »gestorben 1939/45 im Ghetto«. Skrentny sagt: »Da habe ich angefangen zu recherchieren.«
interviews Für die Zeitzeugen war es dabei nicht immer einfach, über die Vergangenheit zu sprechen. Mit Hirschs Tochter Esther, die im Februar 1945 mit ihrem Bruder nach Theresienstadt deportiert worden war, hat Skrentny 2006 ein Interview geführt. »Die Erinnerungen haben sie jedoch sehr aufgewühlt, wir haben die Korrespondenz dann schriftlich fortgeführt«, sagt er.
Auch mit den beiden Töchtern von Gottfried Fuchs in Montreal hat Skrentny gesprochen. Der Karlsruher Mitspieler und Freund von Julius Hirsch war der zweite jüdische Nationalspieler Deutschlands; seine zehn Tore gegen Russland bei den Olympischen Spielen 1912 sind bis heute Rekord. Fuchs und seiner Familie gelang es, 1938 nach Kanada zu emigrieren. »Bei den Gesprächen hat man gemerkt, wie nachhaltig sich die Vertreibung auswirkt«, sagt Skrentny, »es gab zunächst eine gewisse Skepsis«. Fuchs ist nach dem Krieg oft nach Deutschland gereist, aber seinen alten Verein hat er nie besucht – »weil die den Juller Hirsch ermordet haben«, wie er sagt.
Skrentnys Buch dokumentiert auch den langen Weg der Erinnerung an die ermordeten Fußballer. »Der DFB und der KFV haben Hirsch ignoriert«, sagt Skrentny. Dabei hatte Heinold Hirsch beim DFB angeregt, einen Gedenkstein auf dem jüdischen Friedhof Karlsruhe zu errichten. Und als Ex-Bundestrainer Sepp Herberger dem DFB 1972 vorschlug, Gottfried Fuchs zum Olympia-Länderspiel gegen die Sowjetunion einzuladen, lehnte der Vorstand ab: Damals saßen dort noch zwei ehemalige NSDAP-Mitglieder und ein Veteran des SS-Totenkopf-Regiments.
ehrung Inzwischen hat sich viel zum Besseren gewendet. Heute sind nach Julius Hirsch Sportanlagen in Pfinztal und Berlin benannt, vor seinem letzten freiwilligen Karlsruher Wohnsitz liegt ein sogenannter Stolperstein, seit 2005 verleiht der DFB jährlich den Julius-Hirsch-Preis, und während der Fußball-EM wird eine Delegation Auschwitz besuchen und damit auch Julius Hirsch ehren.
Schließlich hat Skrentnys Buch die Familien der Freunde Julius Hirsch und Gottfried Fuchs einander wieder nähergebracht. »Der Enkel von Julius Hirsch, An- dreas Hirsch, hat da guten Kontakt«, erzählt Skrentny. »Und Ende Juli plant die Familie Fuchs eine Reunion in der Nähe von Montreal, zu der auch die Hirschs eingeladen sind.«
Werner Skrentny: Julius Hirsch. Nationalspieler. Ermordet. Biografie eines jüdischen Fußballspielers, Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2012, 352 S., 24,90 €