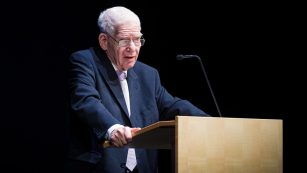»Wenn das Rettungsschiff da ist, reserviere uns einen Platz.« Diesen Scherz hört Eliyahu Raful häufig, wenn er mit Menschen in Israel spricht. »Die Leute machen Witze, aber eigentlich haben sie Angst«, sagt er. Sie wenden sich alle mit derselben Bitte an ihn: Er soll ihnen helfen, deutsche Staatsbürger zu werden. Das tut er. Und die Nachfrage steigt.
»Per Gesetz hat es Deutschland den Menschen einfach gemacht, Anträge zu stellen«, so Raful. »Ich rede jeden Tag mit Interessierten.« Nach Artikel 116 Absatz 2 des Grundgesetzes und Paragraf 15 des Staatsangehörigkeitsgesetzes haben die Nachkommen von NS-Verfolgten, denen zwischen dem 30. Januar 1933 bis zum 8. Mai 1945 die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt wurde, einen Anspruch auf Wiedereinbürgerung. Das Gesetz wurde zuletzt am 20. August 2021 angepasst. Seitdem umfasst es auch die Nachkommen von sogenannten Ostjuden, die wegen der rassistischen Gesetzgebung nie deutsche Staatsbürger werden konnten.
»Israel ist ein kleines Land«, sagt Raful. Viele Israelis würden einen europäischen Pass wollen, etwa damit ihre Kinder die Möglichkeit haben, außerhalb des Landes zu studieren. Aber nur wenige kennen sich mit der deutschen Bürokratie aus. »Wir helfen ihnen mit allem.« Raful hat den Prozess selbst hinter sich und weiß daher, wie kompliziert es ist. Er ist in Bnei Brak bei Tel Aviv aufgewachsen, im Oktober 2020 nach Berlin und später dann nach Dresden gezogen. Seit August 2023 ist er deutscher Staatsbürger. Vor einem Jahr hat er sich mit einer Rechtsanwältin zusammengetan, um anderen Israelis beim Prozess der Einbürgerung zu helfen. Die juristische Expertise ist nötig. Denn trotz der eindeutigen Rechtslage gestaltet sich in der Praxis die Wiedereinbürgerung schwierig, langwierig und kostspielig.
Für die Wiedereinbürgerung sind Urkunden der Vorfahren nötig
Die Antragsteller müssen die Verfolgung ihrer Vorfahren nachweisen, was nicht immer einfach ist. Die Nationalsozialisten haben gezielt Einträge von Juden in den Melderegistern vernichtet. Fremdsprachigen Unterlagen muss eine vereidigte Übersetzung beigelegt sein. Kopien müssen notariell beglaubigt werden, und die Anträge sind nur in Deutsch und Englisch erhältlich. Zwar ist das Verfahren gebührenfrei, aber die aufgewendeten Sachkosten werden nicht ersetzt. Und als Nachweis für die Nachkommenschaft genügen nicht die eigenen Unterlagen. Es können zudem Urkunden der Eltern und Großeltern notwendig sein.
Einige dieser Unterlagen findet man in den Arolsen Archives. Giora Zwilling beantwortet die Anfragen. Der Jüdischen Allgemeinen sagt er, dass diese bereits seit Jahren zunehmen würden – so auch in Yad Vashem, wo die Datenbank der Arolsen Archives ebenso verfügbar ist. Man könne zwar nicht genau wissen, zu welchem Zweck Unterlagen angefragt werden. Doch Zwilling vermutet, dass die letzte Gesetzesänderung in Deutschland eine Rolle spielt und viele Antragsteller auf der Suche nach Unterlagen für ihre Einbürgerung sind.
Raful erklärt sich die steigende Nachfrage nach deutschen Pässen so: »Viele sehen es in Zeiten, in denen die Welt bebt und die Zukunft Israels oder der Welt im Allgemeinen unklar ist, als Sicherheit an, einen anderen Pass zu haben.« Vor allem seit dem 7. Oktober verbinden viele mit einem deutschen Pass die Hoffnung auf Stabilität. »Die meisten haben Angst vor dem, was gerade in Israel passiert.« Raful berichtet von Menschen, die vor dem 7. Oktober 2023 nicht einmal deutsche Produkte gekauft hätten. Das Massaker der Hamas habe deren Einstellung verändert.
20.000 Anträge auf Einbürgerung sind noch unbearbeitet.
Ähnliches bestätigt eine Sprecherin des Bundesverwaltungsamtes der Jüdischen Allgemeinen: »Wir verzeichnen eine deutliche Zunahme der Anträge von Personen mit Wohnsitz in Israel seit Ende 2023.« 53.788 Wiedereinbürgerungsanträge sind laut Bundesverwaltungsamt seit September 2021 insgesamt eingegangen – davon rund die Hälfte seit Oktober 2023. Über 24.490 von ihnen wurde demnach bereits entschieden; circa 85 Prozent positiv. Rund 20.000 Anträge sind noch nicht bearbeitet.
»Grundsätzlich ist die Bearbeitungszeit von der Komplexität des Einzelfalls und der erforderlichen Prüftiefe abhängig«, so die Sprecherin. Die Bearbeitungsdauer reiche daher »von wenigen Tagen bis hin zu mehreren Jahren«. Bei den noch in Bearbeitung befindlichen Anträgen sei die »deutliche Steigerung des Antragsvolumens in der vergangenen Zeit zu berücksichtigen«.
Es kann Monate bis zur Registrierung von Anträgen dauern
Raful hat auch für Familienmitglieder Anträge gestellt. Ihm sei damals gesagt worden, für seine Angehörigen werde es einfacher, sobald er seinen Positivbescheid habe. Seit Anfang des Jahres sind die Papiere seiner Familie beim Bundesverwaltungsamt. Bis auf eine Eingangsbestätigung gab es bislang jedoch keine Antwort. Warum die Bearbeitung bis heute nicht abgeschlossen ist, wollte das Amt nicht beantworten. Man gebe »keine fall- oder personenbezogenen Auskünfte«, hieß es auf Anfrage dieser Zeitung.
Raful berichtet von über 100 Fällen, die er begleitet und die darauf warten, bearbeitet zu werden. Ihm zufolge dauert es meist Monate, bis die Anträge überhaupt registriert werden. »Für die Betroffenen ein unerträglich langsames Tempo.« Also hat er sich nun mit einem Brief an Bundesinnenministerin Nancy Faeser gerichtet: »Die schleppende Bearbeitung ist kein Willkommenszeichen für meine – emotional belasteten – jüdischen Klienten.«
Der Brief ist versehen mit der Bitte, die Bundesregierung möge sich dafür einsetzen, dass die Verfahren deutlich beschleunigt werden. Denn für viele seiner Klienten bedeute die deutsche Staatsbürgerschaft nicht mehr nur die Anerkennung des Unrechts, das ihre Vorfahren erleiden mussten, sondern ganz konkret in Deutschland einen alternativen Lebensort zu haben, an den sie notfalls fliehen könnten.