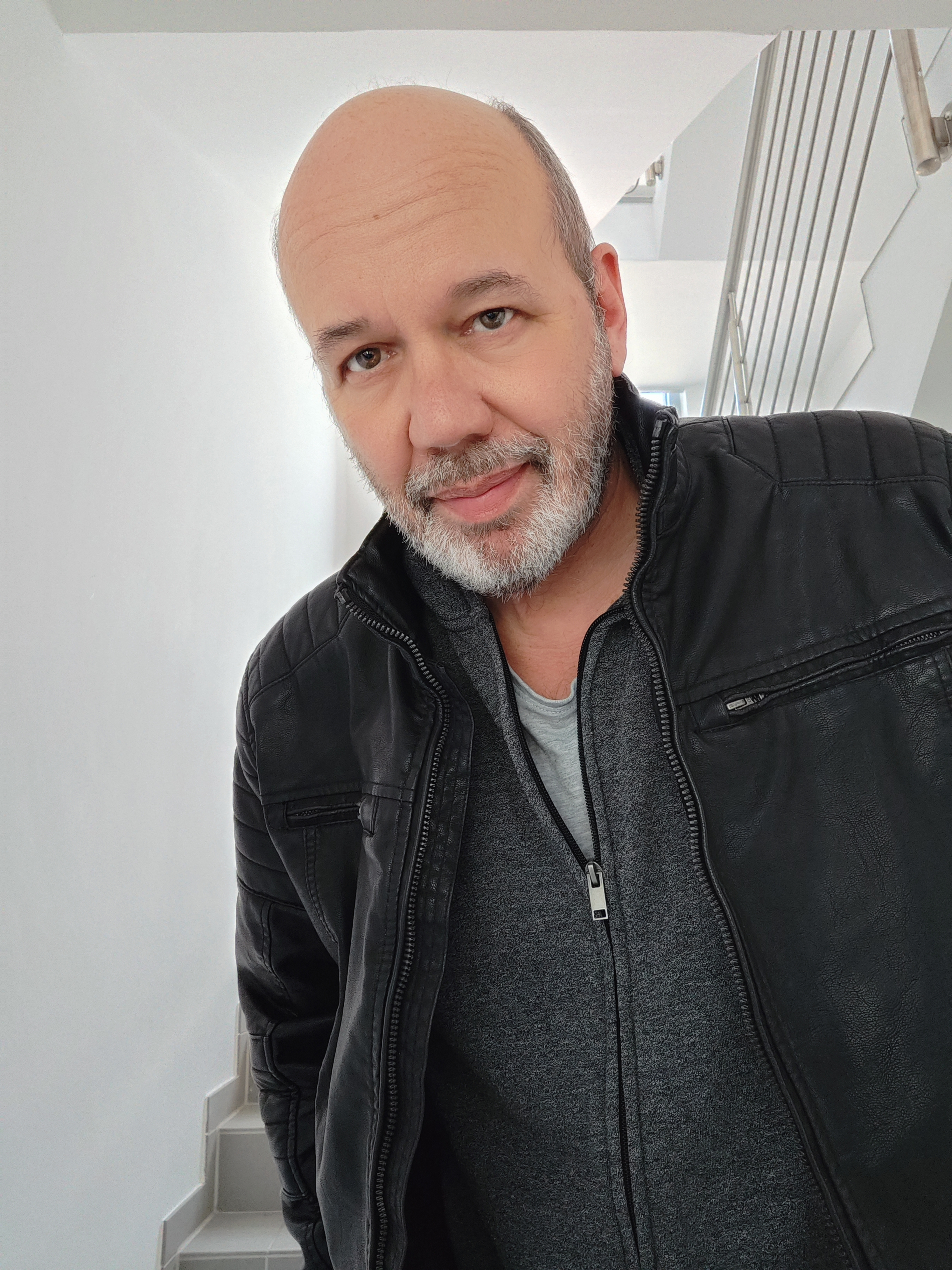»Kunst, Raub und Rückgabe – Vergessene Lebensgeschichten« – mit diesem Erinnerungsprojekt der Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit dem Zentralarchiv der Staatlichen Museen zu Berlin und der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen sollen zukünftig die Lebensgeschichten von »teilweise unbekannten Kunstsammlerinnen und Kunstsammlern, denen die Stücke einst gehörten«, in den Fokus gerückt werden. Das Projekt wird aus dem Etat der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien mit 690.000 Euro gefördert.
»Hinter jedem wieder aufgespürten Werk stehen die Lebensgeschichte und das Schicksal eines Menschen sowie ganzer Familien«, heißt es in der offiziellen Beschreibung des Projekts. Eine »Mediathek der Erinnerung« soll in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk (BR) und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) entstehen. Vor allem an die Opfer des nationalsozialistischen Kunstraubs soll erinnert werden.
Gesellschaft Zentralratspräsient Josef Schuster sprach bei der Auftaktveranstaltung am Donnerstagabend im Berliner Bode-Museum. Er dankte den Organisatoren und sagte, dass das Erinnern an die Schrecken und das maßlose Unrecht der Schoa das Wesen unserer Gesellschaft bestimme. Erinnern sei notwendig.
»Wir leben in Zeiten, in denen Erinnerung zunehmen verblasst«, erklärte Schuster. »Sie verblasst, weil es immer weniger Zeitzeugen gibt. Sie verblasst, weil es immer mehr Menschen in Deutschland gibt, die einen Schlussstrich unter die Vergangenheit - in Klammern - die Zeit des Nationalsozialismus - ziehen wollen.«
Auch verblasse die Erinnerung, da Viele nun die Gelegenheit sähen, sich endlich unangenehmen Fragen darüber zu entziehen, wie das Unrecht »noch lange nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nachwirken konnte und noch immer nachwirkt.« Das neue Projekt sei wichtig, damit die Geschichten von Jüdinnen und Juden nicht verschwänden.
Kritik Josef Schuster kritisierte die bisherige Bilanz in Zusammenhang mit der Rückgabe von Kunst. »Wenn ich ehrlich bin, kann ich von dem Dreiklang dieses Projektes «Kunst, Raub, Rückgabe» nur den ersten beiden Begriffen so richtig folgen.«
Er verwies auf die geringe Zahl von Mediationsverfahren bei der Schiedsstelle der 2003 gegründeten Beratenden Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts, insbesondere aus jüdischem Besitz. Gerade einmal 22 davon habe es bisher gegeben, bei 200,000 gestohlenen Kunstwerken in Deutschland und Österreich während der Nazizeit, und dreimal so vielen in ganz Europa. »Insgesamt fehlt es in Bezug auf die Restitutionsprozesse von NS-Raubkunst an Transparenz und Klarheit«, monierte Schuster.
Umso wichtiger sei es, dass nun schlagartig das Augenmerk auf »diese Geschichten« gelegt werde. Hinter den Zahlen steckten immer Schicksale und Familiengeschichten. »Sie zeigen auch, dass es Sinn ergibt, über diese Sammlerpersönlichkeiten den Zugang zur Provenienzforschung zu legen und nicht nur, wie bisher, über das Objekt. Und diese Geschichten mahnen uns, dass es so nicht weitergehen kann«, sagte der Zentralratspräsident.
Würde Abschließend erklärte Josef Schuster, tausende Familien hätten die Möglichkeit über die Restitution ihres Besitzes »ein Stück ihrer Würde zurück zu erlangen«, die ihnen und ihren genommen worden sei. Dem gegenüber stehe aber »ein verkrustet wirkendes Rechts-Regime, das im Holocaust erlittenes Unrecht scheinbar fortführt.«
Kulturstaatsministerin Claudia Roth sprach ebenfalls bei der Auftaktveranstaltung des Projektes. »Hinter jedem geraubten oder enteigneten Kunstwerk steht die Lebensgeschichte und das erlittene Unrecht eines Menschen«, erklärte sie. »Diesen Biografien hinter den geraubten Kunstwerken nachzugehen, die Vielfalt jüdischer Biografien vor 1933 auszuleuchten, ermöglicht uns ein wichtiges Erinnern für die Zukunft und bleibt eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe.«
Mit dem Projekt leisteten die SPK und die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen einen wichtigen Beitrag. »Das Projekt steht für unsere fortwährende Verantwortung, den NS-Kunstraub und die Menschheitsverbrechen der Shoah konsequent aufzuarbeiten und das Erinnern daran lebendig zu erhalten und allgemein zugänglich zu machen«, so Claudia Roth.
Verbrechen Für die SPK sagte deren Präsident Hermann Parzinger, viele Einrichtungen in Deutschland, inklusive seiner Organisation, hätten Kunstwerke und Bücher restituiert, faire und gerechte Lösungen im Sinne der Nachkommen gefunden. »Aber es bleibt noch sehr viel zu tun, denn der nationalsozialistische Kunstraub ist ein riesiges Verbrechen. Und bei allem geht es nicht nur um Akten, es geht um Menschen, die aus ihren Leben herausgerissen, die verfemt und verfolgt und vernichtet wurden.«
»Ihre Namen und ihre Familien sollten vergessen gemacht werden. Wir möchten an möglichst viele Menschen mit unserem Projekt erinnern und wir möchten damit etwas gegen das Übel des Antisemitismus tun – wo und wie es auch immer auftreten möge«, sagte Parzinger. »Unser Projekt hat einen Pilotstatus. Weitere Einrichtungen können und sollen sich anschließen. Es geht uns darum, möglichst viele dieser vergessenen und erschütternden Biographien erzählen zu können.«
Bernhard Maaz, der Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, ergänzte: »Der menschliche Gedanke, die Ergebnisse der Provenienzforschung nicht allein auf die zu restituierenden Objekte zu beziehen, sondern auch auf die Lebensschicksale ihrer einstigen Eigentümer, liegt nahe. Lange sah man vorrangig auf den Erinnerungswert der Kunstwerke, so wie es ja auch mit der Washingtoner Erklärung beabsichtigt ist. Doch wer sind die Nachfahren, wer geht mit diesen Objekten heute auf welche Weise um?«
Kommunikation Berlin als »Hauptstadt des Deutschen Reichs« und München als sogenannte »Hauptstadt der Bewegung« hätten mehr als viele andere Städte Anlass, diese Themen aktiv aufzuarbeiten, erklärte Maaz. »Das Interesse an der gemeinsamen Kommunikation für eine breite Öffentlichkeit verband uns.«
Die Moderatorin der Auftaktveranstaltung war die Journalistin und Autorin Shelly Kupferberg. Gezeigt wurden Filme zu den Lebensgeschichten von Friedrich Guttsmann und August Liebmann Mayer. Guttsmann (1888-1959) war Kaufmann. Aufgrund seiner jüdischen Herkunft verlor er nach 1933 seine Anstellung und die Familienwohnung in Berlin. Die Notlage zwang ihn zum Verkauf seiner Kunstgegenstände.
August Liebmann Mayer (1885-1944), ein Experte für Malerei, war Konservator an den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und Professor für Kunstgeschichte an der Münchener Universität. Die Nationalsozialisten beschlagnahmten ab 1933 seinen Besitz. Auch Miriam Friedmann und weitere Angehörige von Betroffenen kamen live und in Videobeiträgen zu Wort.
Selbstrestitution Ann-Charlott Mörner, die Enkelin von Friedrich Guttsmann, wurde vor Ort befragt, ebenso wie Hermann Simon, der Gründungsdirektor des Centrum Judaicum Berlin, der von der Restitution von Büchern sprach und den Begriff der »Selbstrestitution« in die Gesprächsrunde warf, in dem er ein Buch, das ursprünglich seinem Großvater gehörte, an sich nahm.
Die 14-jährige Schülerin Emma Abel stellte während der Veranstaltung ihr Buch Nur die Sterne schienen gelb zu leuchten vor. Sie beschäftigt sich seit mehreren Jahren intensiv mit dem Holocaust und hat im Rahmen einer schulischen Arbeit einen Roman über das Verfolgungsschicksal eines jüdischen Mädchens verfasst.