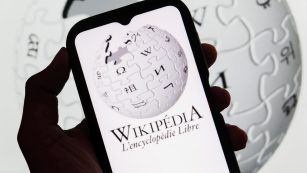Der 9. November ist der Schicksalstag der Deutschen. 1918 riefen sie gleich zwei Mal die Republik aus, 1923 verteidigten sie sie gegen den österreichischen Gefreiten beim Münchner Putsch, 1938 zündeten sie im ganzen Reich die Synagogen an und 1989 stürmten sie die Berliner Mauer. Kein Wunder, dass in der Öffentlichkeit gelegentlich der Ruf zu hören war, dies sei der eigentliche Nationalfeiertag Deutschlands.
stagnation Für die Juden in Deutschland brachte der 9. November 1989 Konsequenzen mit sich, die vorher kaum jemand erahnen konnte. Die jüdische Gemeinschaft in der Bundesrepublik stagnierte damals bei einer Mitgliederzahl von unter 30.000, die Gemeinden in der DDR hatten weniger als 400 Mitglieder – Tendenz in beiden Staaten fallend. Hätte 1989 jemand vorausgesagt, in Deutschland würden 20 Jahre später etwa 200.000 Juden zu Hause sein, man hätte ihn schlichtweg für verrückt erklärt.
Mit dem Fall der Mauer und dem Zerfall der Sowjetunion hatten nun die über zwei Millionen Juden in der ehemaligen UdSSR die Möglichkeit, das Land zu verlasen. Über eine Million ging nach Israel, einige Hunderttausende nach Amerika. Doch nicht alle wollten ins zwar heilige, aber auch konfliktgebeutelte Land ziehen, und nicht alle konnten in die Goldene Medine, denn diese hatte gerade ihre Einwanderungsbestimmungen verschärft. Deutschland war wohl das einzige Land, das aufgrund seiner Geschichte nicht dichtmachen konnte, wenn Juden an seine Türen klopften. Der Bundestag war sich einig wie selten, als Ende 1990 über die jüdische Zuwanderung aus der Sowjetunion diskutiert wurde.
»Kontingentflüchtlinge« So kam im Laufe der nächsten beiden Jahrzehnte etwa eine Viertelmillion sogenannter »Kontingentflüchtlinge« nach Deutschland. Wie viele von ihnen im strengen halachischen Sinn Juden waren, ist nicht genau zu bestimmen. Doch auch wenn viele nichtjüdische Familienangehörige darunter waren, einige ihre jüdische Identität gefälscht hatten und manche sich weigerten, einer Gemeinde beizutreten – die Zahl der Mitglieder in den deutschen Gemeinden vervierfachte sich in kurzer Zeit.
In den GUS-Staaten war es nun plötzlich »in«, Jude zu sein, denn so konnte man ausreisen. Welche Ironie der Geschichte für Russland – aber auch für Deutschland. Das Land, in dem nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich keine Juden mehr leben sollten, wurde nach 1989 zu dem Staat mit der am schnellsten wachsenden jüdischen Bevölkerung in der Diaspora. Der Integrationsprozess war zwar auch für die »alten« Gemeindemitglieder nicht immer einfach, doch eines steht fest: Ohne diese Zuwanderung gäbe es heute nur noch wenige jüdische Gemeinden in Deutschland.