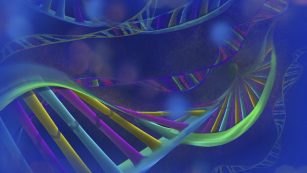Israeli zu sein in Europa – das war einmal eine Einladung zum Gespräch. Es bedeutete Interesse, Austausch, oft auch Sympathie. Heute bedeutet es für viele: Gefahr. Wer seine Herkunft offenbart, riskiert Ablehnung, Anfeindung, im schlimmsten Fall Gewalt. Der israelische Pass, ein Wort Hebräisch, ein T-Shirt mit hebräischer Aufschrift: das reicht inzwischen, um zur Zielscheibe zu werden.
Auf Rhodos wurde kürzlich eine Gruppe israelischer Jugendlicher von einem Mob mit Messern durch die Straßen gejagt. Auf der griechischen Insel Syros blockierten Demonstranten ein Kreuzfahrtschiff mit hunderten israelischen Touristen. Es durfte nicht anlegen. In Belgien, beim Tomorrowland-Festival, wurden zwei junge Israelis festgenommen. Der Vorwurf: Sie seien Soldaten einer kriegführenden Armee, mutmaßliche Kriegsverbrecher. Belege? Keine. Ihre Herkunft allein genügte.
Was sich hier abzeichnet, ist keine politische Debatte mehr, sondern eine Form der Kollektivverurteilung. Die Herkunft ersetzt die Tat. Die Identität ersetzt das Argument.
Menschen werden entindividualisiert, auf ein politisches Feindbild reduziert. Die Zivilistin im Sommerkleid wird zur Soldatin. Der Austauschstudent zum Sprachrohr einer Armee. Der bloße Umstand, aus Israel zu kommen, genügt, um kriminalisiert zu werden – in Cafés, an Häfen, auf Festivals. Und das nicht irgendwo, sondern mitten in Europa.
Es reicht ein Name, eine Sprache, eine Geste – schon steht ein Verdacht im Raum. Viele Israelis meiden Europa inzwischen nicht aus Trotz, sondern aus Angst. Das israelische Außenministerium rät mittlerweile, im Ausland möglichst keine hebräische Sprache oder jüdische Symbole zu zeigen. Ein Hinweis, der sich nicht wie Sicherheitsvorsorge anfühlt, sondern wie Selbstverleugnung.
Gleichzeitig betonen europäische Regierungen ihre Solidarität mit Israel. Die griechische ebenso wie die deutsche. Doch was nützen diplomatische Bekenntnisse, wenn am Hafen von Syros hunderte Menschen brüllen, Israelis seien Mörder? Was hilft politische Freundschaft, wenn sich Jugendliche in Rhodos hinter Autos verstecken müssen, um nicht angegriffen zu werden?
Diese doppelte Realität ist nicht zu übersehen: Pro-israelische Rhetorik auf Regierungsebene, offene Feindseligkeit auf den Straßen. Dazwischen stehen Menschen, die vielleicht einfach nur reisen wollten. Die mit der Politik ihres Landes womöglich nichts zu tun haben, sich für Sonne, Kultur oder Gemeinschaft interessieren. Aber sie werden nicht als Gäste gesehen, sondern als Schuldige.
Das ist keine »Israelkritik«. Das ist kollektive Ausgrenzung. Wenn ein israelischer Student in Amsterdam verprügelt wird, weil er ein Trikot seines Fußballvereins trägt, dann sind wir nicht im Diskurs, dann geht es längst nicht mehr um politische Haltung – sondern um ethnische Zuschreibung. Um alte Muster.
Wenn jüdisches Leben in Europa wieder flüstern muss, wenn israelische Besucher ihre Identität verstecken sollen, dann hallt die Geschichte wie ein Echo durch die Straßen. Denn die Frage ist nicht, ob wir etwas gelernt haben. Die Frage ist, ob wir uns noch erinnern wollen.
Der Autor ist freier Journalist, wuchs in Deutschland auf und lebt seit 2011 in Israel.