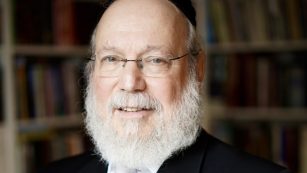Die Aussage der Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik ließen viele aufhorchen: Juden und queere Menschen, die sich als solche zu erkennen geben, sollten in bestimmten Stadtteilen der Hauptstadt besonders aufmerksam sein. Beschönigend als Vorsichtsmaßnahme formuliert, offenbaren diese Worte in Wahrheit ein Eingeständnis, dass der Staat seiner Kernaufgabe, dem Schutz seiner Bürgerinnen und Bürger, nicht mehr vollumfänglich gerecht wird.
Was zunächst wie ein lokales Berliner Problem erscheint, offenbart bei genauerem Hinsehen eine beunruhigende gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die Parallelen zur Weimarer Republik aufweist: Auch damals begann der Verfall demokratischer Institutionen nicht mit einem lauten Knall, sondern mit der schleichenden Akzeptanz von Unrecht. Nach vereinzelten antisemitischen Übergriffen, zum Beispiel in universitären Kreisen, entstanden ab Mitte der 1920er Jahre »No-Go-Areas« für Juden. Bestimmte Badeanstalten, Restaurants oder Ferienorte verwehrten Juden den Zutritt – Jahre bevor Nationalsozialisten die Macht übernahmen und die staatliche Verfolgung einsetzte.
Die zunehmende Verdrängung der jüdischen Bürgerinnen und Bürger aus dem öffentlichen Raum, war damals wie heute ein Warnsignal für die Erosion staatlicher Schutzpflichten. Wenn der Staat nicht mehr die Sicherheit aller Bürger garantieren kann, ist dies kein isoliertes Problem einer Minderheit – es ist ein Anzeichen für den Beginn einer schleichenden Demontage von demokratischen Grundrechten.
Die Frage ist, wie wir als Staat und Gesellschaft dieser Entwicklung entschlossen entgegentreten können.
Allein im Jahr 2023 wurden bundesweit 5.164 antisemitische Straftaten registriert. Dies entspricht in etwa einer Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr. Besonders seit dem 7. Oktober 2023 hat sich die Bedrohungslage drastisch verschärft. Das kürzlich stattgefundene Pogrom auf Fußballfans in Amsterdam, bei dem propalästinensische Gruppen systematisch Jagd auf Jüdinnen und Juden machten und mehrere Menschen verletzt wurden, hat viele jüdische Menschen an dunkle Kapitel der europäischen Geschichte erinnert, die sie überwunden geglaubt hatten. Auch in Berlin scheint die Gefahr solcher Szenen wieder real.
Die Zeit des Wegduckens muss vorbei sein. Die Frage ist nicht mehr, ob wir handeln müssen, sondern wie wir als Staat und Gesellschaft dieser Entwicklung entschlossen entgegentreten. An erster Stelle sollte die konsequente Durchsetzung der Rechtsordnung durch staatliche Institutionen stehen, begleitet von systematischer Präventionsarbeit. All das bedarf jedoch eines klaren politischen Willens und der Bereitstellung benötigter Mittel.
Versagen wir bei dieser Aufgabe, droht die schleichende Etablierung rechtsfreier Räume und damit der Anfang vom Ende unserer liberalen Gesellschaftsordnung. Die Geschichte lehrt uns: Wo Juden nicht mehr sicher leben können, ist bald niemand mehr sicher.
Der Autor ist Politikwissenschaftler und freiberuflicher Journalist.