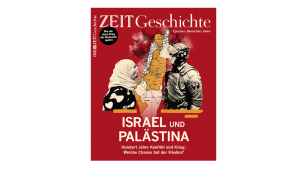In der vergangenen Woche hat angesichts der neuerlichen Offensive im Gazastreifen und der Besorgnis über Vertreibungsfantasien israelischer Regierungsmitglieder die Kritik an Israel massiv zugenommen. Auch die Bundesregierung hat jüngst ihren Ton gegenüber Jerusalem drastisch verschärft und die humanitäre Situation im Gazastreifen als inakzeptabel verurteilt.
Zu beobachten ist, wie auch deutsche Medien um angemessene Worte und Reaktionen ringen. Auffallend an manchen Kommentaren ist eine mitschwingende Genugtuung darüber, dass man jetzt endlich, so der imaginierte Tabubruch, auch in Deutschland trotz Holocaust und Staatsräson Israel richtig kritisieren dürfe.
Zwei Vorwürfe werden besonders laut erhoben: Aus Deutschland werde nur verhalten Kritik an Israel geäußert, die »Staatsräson« sorge dafür, dass Palästinasolidarität kriminalisiert und das Leid der Zivilbevölkerung vergessen werde. Es ist müßig, die deutsche Kritik an Israel, die seit jeher auch in bürgerlichen Medien geübt wird und in den letzten Monaten deutlich vernehmbar war, hier durch Beispiele zu entkräften. Viel gravierender ist ein zweiter Vorwurf, wonach die angeblich ausbleibende Kritik eine falsch verstandene Lehre aus dem Holocaust sei.
Die Axt wird an den labilen bundesrepublikanischen Konsens gelegt, dass Deutschland die Schande seiner Taten – zurecht – immer mit sich tragen wird.
»Schluss mit dem deutschen Rumgedruckse« wird in einem Spiegel-Leitartikel gefordert. Die Frage sei, welche Lehre man aus dem Holocaust ziehen wolle: »Deutsche sollten gelernt haben, dass Wegschauen auch Unrecht bedeuten kann.« Mit zwei Federstrichen werden nicht nur Holocaust und Gaza-Krieg in einen Deutungszusammenhang gestellt, sondern auch des Deutschen heutiges Verhalten vergleichbar gemacht mit seinem Wegschauen während des systematischen, industriellen Massenmords im Nationalsozialismus. »Das deutsche Schweigen zu Gaza geht in die Geschichte ein. Jetzt geht es nur noch um Schadensbegrenzung. Besser spät als nie«, heißt es denn auch am Schluss.
Im Stern geht man noch weiter. Selbst entlarvend schreibt der Autor an einer, nach Kritik mittlerweile geänderten Stelle: Es sei billig, dass die Deutschen, geschützt durch Anonymität, in Umfragen mehrheitlich Israels Kriegsführung kritisierten. Dies müsse vielmehr endlich »offener und frei vom Würgegriff der Kollektivschuld« geschehen. Welche Kollektivschuld trifft ihn, den 1996 geborenen? Welcher Würgegriff? Weiß er, dass das Bild der vom »Juden« in den Würgegriff genommenen Völker eine traditionelle antisemitische Zuschreibung ist?
Ganz ähnlich äußerte sich Freitag-Verleger Jakob Augstein jüngst im gemeinsamen Podcast mit ntv-Politikchef Nikolaus Blome. Der Satz »Free Palestine from German Guilt« sei eigentlich nicht antisemitisch zu verstehen und die ihn skandierenden Protestler und Studenten hätten womöglich Recht. Richtigerweise weist Blome ihn auf den Kontext, in dem der Slogan gegrölt wird, hin: Intifada-Aufrufe und »From the river to the sea«-Sprechchöre, Sticker und Karten, auf denen das israelischen Staatsgebiet in den Farben der palästinensischen Flagge ausgemalt ist. Die Implikation ist klar: die Vernichtung des einzigen jüdischen Staates.
Das Raunen von einem vermeintlichen »Schuldkult« ist nicht neu. Kunzelmann, der Historikerstreit, Walsers Ausfälle in der Paulskirche, Augsteins Gezeter gegen das Holocaust-Mahnmal. Seit Jahrzehnten hört man es von rechts, in den vergangenen Jahren vermehrt auch von links und nun offenbar aus der medialen Mitte. Damit legt man die Axt an den labilen bundesrepublikanischen Konsens, dass Deutschland die Schande seiner Taten – zurecht – immer mit sich tragen wird. Dass es das Land der Täter und ihrer Nachfahren ist und die daraus erwachsende Verantwortung Teil seiner Identität und der seiner Bürger ist.
Vor wenigen Tagen wurden 60 Jahre deutsch-israelische Beziehungen begangen. Die enge Freundschaft der beiden Länder ist, wie sich an den jüngsten Äußerungen der Bundesregierung erkennen lässt, genau jenes notwendige Fundament, um harte Kritik am israelischen Vorgehen üben zu können, Kriegsverbrechen zu verurteilen und sich stärker um Frieden in Nahost zu bemühen.
Der Autor studiert an der Universität der Künste in Berlin und ist Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung.