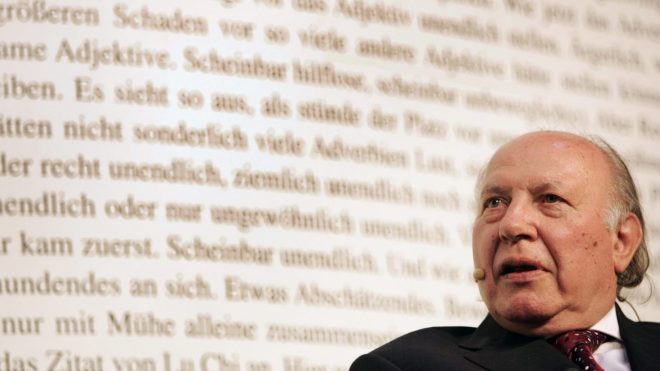Imre Kertész überlebte als 15-Jähriger die Holocaust-Hölle von Auschwitz und Buchenwald. Darüber schrieb der ungarische Literaturnobelpreisträger den erst mit Verzögerung berühmt gewordenen und später auch verfilmten Roman eines Schicksallosen.
Aus den jetzt in der von der Berliner Akademie der Künste herausgegebenen Zeitschrift »Sinn und Form«, die damit auch an ihr 70-jähriges Bestehen erinnert, erstmals publizierten Tagebuch- beziehungsweise Arbeitsnotizen aus den Jahren 1959 bis 1962 geht hervor, dass Kertész einen »Zweiten-Weltkriegs-Zauberberg« plante. Also Thomas Manns Geschichte von Hans Castorp zwischen Leben und Tod »im Spiegel einer durchschnittlichen Seele« neu zu schreiben.
Diese durchaus aufsehenerregenden Notizen ermöglichen eine neue oder zumindest erhellende Sicht auf den Roman, und dies, wie der Zufall es will, gleichzeitig mit der jetzt als Wiederholung ausgestrahlten und seinerzeit spektakulären amerikanischen Fernsehserie Holocaust von 1978.
Synthese Kertész wollte nach eigenen Worten eine »Synthese zwischen dem Humanismus Thomas Manns und dem Existenzialismus Sartres« erreichen. Auch Der Fremde von Albert Camus war für ihn eine wichtige Inspiration, aber Camus, Sartre, Beckett oder Huxley fehle die Authentizität, wie Kertész notierte. Poesie ohne eigenes Erleben sei wenig wert, »alles andere ist bloß gedankliches Looping, ehrbares Posieren, fruchtloses In-Schrecken-Versetzen«.
Kertész selbst ruft Momente
der »zerstörend süßen Selbstaufgabe«
im Lager zurück.
So seien seine Erinnerungen und Aufzeichnungen unter anderem vom »Geruch des Wassers in Auschwitz« und dem »dunstigen Sonnenschein im Hof des KZ« geprägt. »Mein Leser muß diesen lebensgefährlichen Zauber des Todeslagers verspüren, sonst kann der Roman sich in die anderen einseitigen und öden Lagerromane einreihen.«
Tod In diesem Zusammenhang spricht Kertész nicht nur von einem Deportations-, Anpassungs- oder Halbwüchsigen-Roman, sondern auch von seinem »Muselmann«-Projekt. Der veraltete Ausdruck für Muslim wurde in Konzentrationslagern für Häftlinge benutzt, die durch völlige Entkräftung sowie Verzweiflung und in totaler Hoffnungslosigkeit kurz vor dem Tod standen. »Der Muselmann leidet nicht«, schreibt Kertész. »Der Mensch kann niemals so nahe bei sich selbst und bei Gott sein wie der Muselmann unmittelbar vor dem Tod. Denn einen echten Muselmann, den echten, kann man im Endstadium nicht mehr retten.«
Kertész selbst ruft in seinen Arbeitsnotizen Momente der »zerstörend süßen Selbstaufgabe« des Häftlings mit der Nummer U 64921 im Lager zurück. »Ich erinnere mich, daß es einen Punkt gibt, an dem selbst der Hunger vergeht und auch das Frieren, so daß wir in unseren dünnen Häftlings-Pyjamas ruhig im strömenden Herbstregen herumstehen können, wir frieren überhaupt nicht.« Man habe sich vollkommen in sich selbst zurückgezogen.
Am Ende seines Romans eines Schicksallosen heißt es: »Denn sogar dort, bei den Schornsteinen, gab es in der Pause zwischen den Qualen etwas, das dem Glück ähnlich war.« Zum Beispiel, wie es im Roman heißt, wenn es sich nach zehn oder 20 Minuten Warten entschied: »Gleich das Gas oder noch einmal davongekommen.«
Bildungsroman Die Geschichte seines »Bildungsromans«, meint Kertész, sei schlicht die Geschichte eines lebenshungrigen Heranwachsenden, der in ein KZ gerät und sich »ganz der subtilen Esoterik eines Krankenzimmers hingibt« und danach seinen Platz in der »Welt der Ordnung« nicht mehr finden kann. Im KZ macht der Jugendliche eine für ihn erstaunliche Beobachtung. Die deutschen Soldaten, die er ja auch schon zu Hause in Budapest gesehen hatte, bewegten sich in Auschwitz »irgendwie heimischer«, lässiger.
Im Roman hat der Jugendliche das Gefühl, »plötzlich in irgendein sinnloses Stück hineingeraten zu sein«.
Kertész spricht von »monströsen Sinnlosigkeiten«, man habe »alles hinzunehmen, wie es ist: Vater, Mutter, die Scheidung der beiden, die Stiefmutter, die Schule, den Krieg, den gelben Stern, die SS-Soldaten, das Konzentrationslager und das mehrfache Entkommen vor dem sicheren Tod, so würden «unsere Spiele so krankhaft und pervers». Im Roman hat der Halbwüchsige das Gefühl, «plötzlich in irgendein sinnloses Stück hineingeraten zu sein».
Thomas Mann Und so lässt denn Kertész auch am Ende des Romans eines Schicksallosen seinen jugendlichen «Helden» sagen: «Ich werde mein nicht fortsetzbares Dasein fortsetzen.» In Thomas Manns Bildungsroman Der Zauberberg von 1924 mit der Schluss-Überschrift «Der Donnerschlag (der Erste Weltkrieg)» im letzten Kapitel schreibt der Autor über seinen Helden Hans Castorp («des Lebens treuherziges Sorgenkind», das mit Schuberts «Lindenbaum» auf den Lippen in den Krieg zieht): «Fahr wohl ... wir möchten nicht hoch wetten, daß du davonkommst.»
Kertész sprach 2007 im Deutschen Bundestag zum Nationalen Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus. Für den Verleger und früheren Kulturstaatsminister Michael Naumann war Kertész «einer der radikalsten Kritiker des totalitären Denkens». Der am 9. November 1929 geborene Kertész, der auch längere Zeit in Berlin lebte, starb am 31. März 2016 in seiner Vaterstadt Budapest.