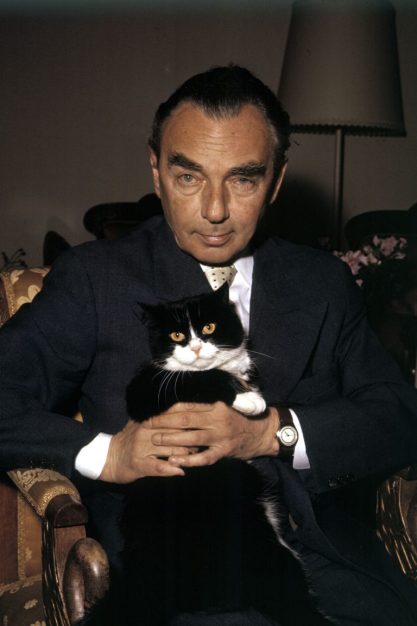Wer liest heute noch Lyrik? Wer tut sich das noch an, gebundene Sprache mit Rhythmus und Reim? Einer dieser Menschen bin ich. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass Lyrik etwas Gesundheitsförderndes hat. Etwas Antitoxisches. Etwas Desinfizierendes. Lyrik vermag Wunden vielleicht nicht zu heilen, sie kann aber immerhin dazu beitragen, dass sie weniger schmerzen.
Das wusste bereits Erich Kästner, weshalb er einen seiner Gedichtbände wohl Lyrische Hausapotheke genannt hatte. Die Anthologie erschien 1936 in der Schweiz und damit drei Jahre nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Kein Zufall übrigens, denn im gleichen Jahr gründete der deutsch-jüdische Verleger Kurt Maschler den Atrium Verlag in Basel, vor allem auch, um das Werk von Erich Kästner weiter publizieren zu können, das in Deutschland seit 1933 verboten war.
Man kriegt Medizin, »wenn uns die Großstadt zum Hals heraushängt«.
Der Gedichtband ist »der Therapie des Privatlebens« gewidmet und die Gebrauchsanweisung wurde sozusagen mitgeliefert: Man lese, welche Seiten aufzuschlagen sind, etwa »wenn man an die Jugend denkt« oder »wenn das Alter traurig stimmt«, oder »wenn das Glück zu spät kommt«. Man kriegt Medizin, »wenn man in der Fremde ist«, »wenn die Ehe kaputtgeht« oder auch nur »wenn uns die Grossstadt zum Hals heraushängt« und »wenn schlechtes Wetter ist«.
Kästner skizzierte mit sehr spitzer Feder die kleinen und großen Schwierigkeiten der menschlichen Existenz, skurrile Situationen, Nöte und Sorgen sowie Melancholie oder auch die tägliche Situationskomik. Es ist ein Band, der so gar nicht akademisch anmutet, sondern sein Publikum konfrontiert, amüsiert, ja zum Lachen bringt, ohne Tiefe entbehren zu müssen. Der Dichter schrieb selbst in seinem Vorwort dazu, es sei »ein Nachschlagewerk, das der Behandlung des durchschnittlichen Innenlebens gewidmet ist«. Vielleicht war es auch nur eine gute Marketingstrategie, Gedichte auf diese therapeutische Art anzupreisen.
Aber verfügen wir nicht alle über dieses manchmal geschwächte genauso wie kränkelnde »durchschnittliche Innenleben«, das »Dr. Kästner« zu behandeln versuchte? Einer, dem die Lyrische Hausapotheke im Warschauer Getto über schwere Zeiten hinweghalf, war Marcel Reich-Ranicki, der später zum wichtigsten Literaturkritiker Deutschlands werden sollte. Er berichtet in seiner Autobiografie, dass ihn Gedichte an die Weimarer Republik und damit an seine Kindheit erinnerten. Seine Frau Teofila, die später übrigens als Grafikerin arbeitete und Illustrationen zu mehreren Buchausgaben von Erich Kästner schuf, hatte damals Marcel den Band zu seinem 21. Geburtstag geschenkt. Gerade weil Kästners Verse nicht die entsetzliche Gegenwart des Kriegs einfingen, sondern weil sie an unbeschwerte Jahre in Berlin erinnerten, berührten Marcel Kästners leichte, aber nie billigen Rezepte.
In Kästners Lyrik wird Melancholie zum kritischen Thema.
»Die Einsamkeit, die Enttäuschung und das übrige Herzeleid zu lindern, braucht es andre Medikamente. Einige davon heißen: Humor, Zorn, Gleichgültigkeit, Ironie, Kontemplation und Übertreibung. Es sind Antitoxine« – oder mit anderen Worten: Wir brauchen Kästner. Auch dann, wenn wir liebend und nicht mehr liebend sind. Das Stichwort liefert dazu das Gedicht Sachliche Romanze und zwar in leuchtend grellen Lettern, als würden sie bunt am Hauptportal vorm Lichtspielhaus auf dem Tauentzien fluoreszieren.
Wenn in diesem vierstrophigen Gedicht, im Wechsel zwischen Jambus und Daktylus, beschrieben wird, wie ein Paar, das unvermittelt feststellt, dass ihm die Liebe füreinander abhandengekommen ist »wie andern Leuten ein Stock oder Hut«, dann wird auf einmal spürbar, wie der Zerbrechlichkeit der Liebe ein betont sachlich und distanzierter Ton entgegengesetzt wird – was vermutlich das Schmerzhafteste überhaupt bei zerbrochener Liebe ist.
Das Oxymoron, dass Sachlichkeit jede Art von Romantik ausschließt, könnte diesen Widerspruch, der beim Scheitern einer Beziehung wohl keiner mehr ist, nicht besser auffächern. In Kästners Liebeslyrik, die sich keinesfalls auf gefühlsduseliges Schwelgen in Trübsinn und Einsamkeit reduzieren lässt, sondern wo Melancholie zum kritischen Thema wird, entpuppt sich die Trostlosigkeit dieses scheinbar Abgebrühten in Wahrheit zu etwas Todtraurigem und damit Urmenschlichem. Und nicht zuletzt findet sie ihre Entsprechung in charakteristischen Orten: im Möblierten, im Café oder im Durchzug des Bahnsteigs etwa, auf dem sich die Liebenden oder Trennenden zum Stelldichein oder zum Seitensprung treffen, gehetzt oder verstohlen, nur, um sich sogleich wieder verlassen zu müssen und einsam zu bleiben.
Textimmanentes Lesen zum Trotz – 1926 trennte sich Erich Kästner von seiner Jugendliebe Ilse Julius, mit der er sieben Jahre lang liiert war. Offenbar kam es zu einer sehr langen Aussprache, die wegen der bevorstehenden Abreise Ilses »schnell vom Zaun gebrochen werden musste«, und von der Kästner, ganz im Tonfall des späteren Gedichts, seiner Mutter berichtete: »Also die Hauptsache: Zwischen Ilse und Erich ist’s aus. Sie machte mir bis 8h damit das Leben noch einmal schwer, dass sie behauptete: sie habe mich trotz allem lieb.« Darauf habe Kästner ihr erklärt, »seit 6 Jahren etwa weißt Du, dass Du mich nicht liebst und nie geliebt hast.«
Kästner, offensichtlich selbst nicht immer erfolgreich in Liebesangelegenheiten, war ein Mann voller Widersprüche. Vor 125 Jahren kam er in Dresden zur Welt, in »Als ich ein kleiner Junge war« beschreibt er seine Kindheit bunt und mit viel Verkehrslärm. Es war wohl das Kinderbuch (erschienen 1957), das am meisten autobiografisch geprägt war. Der Text endet mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges, den Kästner, der damals 15 Jahre alt war, später als das Ende seiner Kindheit betrachtete.
Kästner kam in Dresden zur Welt.
Auch Pünktchen und Anton und Protagonist Emil aus Emil und die Detektive sind offensichtlich durch Kästners eigene Kindheit inspiriert und weisen Parallelen zu Kästners Beziehung zu seiner Mutter, die wie Emils Mutter ein Friseurgeschäft betrieb, auf. Kästners Zeit als externer Schüler eines Internats verarbeitete er unter anderem in Das fliegende Klassenzimmer. Der Sohn einer Helikopter-Mutter vor allem aber Schöpfer grandioser Kinderbücher war geplagt von Schreibblockaden und Alkoholproblemen. Aber er war auch ein Allrounder, sowohl als Schriftsteller, Publizist sowie als Drehbuchautor, Lyriker und Kabarettdichter. Und nicht zuletzt ein Glücksfall für die Kinderliteratur, die er gewissermassen revolutioniert hatte.
Bis in die 1930er-Jahre hinein war es üblich, Kinder als devote kleine Menschen darzustellen. Es wäre verkannt zu sagen, der Dresdner Autor war nur der Anwalt der Kinder. Aber er beobachtete die Erwachsenenwelt durch die Brille eines Kinder, die nicht hätte schärfer sein können. Er gab Kindern eine Stimme, die vorher kaum so in der Kinderliteratur wahrnehmbar war. Er traute ihnen auch einiges zu, zeigt sie als aufgeweckte Persönlichkeiten, die klarmachen, wenn etwas falsch läuft – und sich darum kümmern, damit es wieder richtig läuft. Mit anderen Worten: Kästners junge Protagonistinnen und Protagonisten beweisen Zivilcourage, sind klug aber vor allem nicht auf die häufig so aufgedrückte Hilfe der Eltern angewiesen. Dieser ehrlichen Affinität zur aufrichtigen Kindheit ist sein weltweiter Ruhm vermutlich am meisten zu verdanken. Mit Emil und die Detektive (1929), Pünktchen und Anton (1931), Das fliegende Klassenzimmer (1933) und Das doppelte Lottchen (1949) schuf er eine Welt aus unterschiedlichen Millieus. Scheidungskinder oder solchen, die zu wenig Geld hatten, um an Weihnachten nach Hause zu fahren, begegnet er mit Würde. Dabei sich nie die Kindheit austreiben lassen, »denn nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch.« Ja, wir brauchen Erich Kästner.