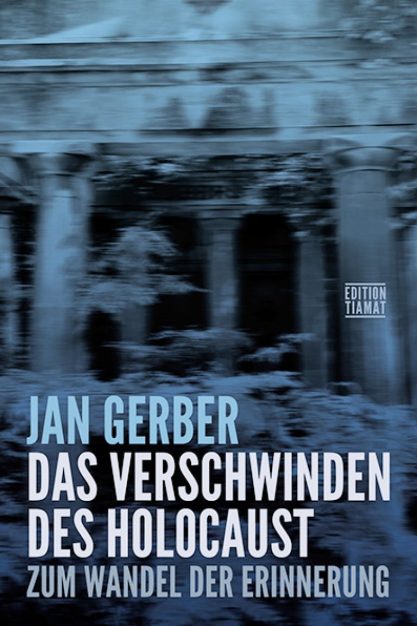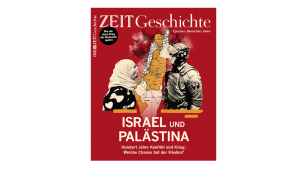Der Buchtitel Das Verschwinden des Holocaust mag auf den ersten Blick irritieren. Denn gefühlt ist dieser omnipräsent, vor allem in aktuellen Debatten, die wenig mit dem eigentlichen Verbrechen zu tun haben – dem Völkermord an den Jüdinnen und Juden im deutschen Herrschaftsbereich. Außerdem ist Auschwitz zur Bezugsgröße per se geworden, wenn es um echte oder imaginierte Kriegsverbrechen geht, Kontroversen um die Geschichte und ihre Deutung oder sogar den Umgang mit Tieren – man erinnere sich an die unsägliche Kampagne »Der Holocaust auf Ihrem Teller« der Tierrechtsorganisation PETA.
Trotzdem, so die These von Jan Gerber, sei der Holocaust dabei zu »verschwinden« – ein Umstand, der keinesfalls damit in Zusammenhang stehe, dass es bald keine Zeitzeugen mehr gibt. Die Ursachen seien woanders zu suchen, und das verheißt nichts Gutes. »Der Wille und die Fähigkeit, zwischen Antisemitismus und Rassismus, dem Nationalsozialismus und den Kolonialregimes, dem Holocaust und anderen Untaten zu differenzieren, schwinden«, konstatiert der Historiker. »Begriffe erodieren, das Unterscheidungsvermögen und die Urteilskraft lassen nach.«
Für Dimensionen und Sinnlosigkeit des Holocaust gab es zunächst keine Begriffe
All das geschah nicht über Nacht, sondern hat eine lange Vorgeschichte. Diese legt Gerber Schicht um Schicht frei, beginnend mit den Versuchen von Intellektuellen wie Jean-Paul Sartre oder Simone de Beauvoir, die »jüdische Katastrophe« in den letzten Kriegsjahren und unmittelbar nach 1945 als etwas Präzedenzloses in Worte zu fassen. Bereits das sollte zu einem Problem werden, das lange nachwirkte. »Die Ursache dieser blockierten Wahrnehmung des Holocaust war zunächst das Geschehen selbst«, so Gerber. Für dessen Dimensionen und dessen Sinnlosigkeit gab es zunächst keine Begriffe.
Aber auch andere Themen überlagerten die Rezeption, allen voran Hiroshima und die Angst vor dem Atomtod, die dafür sorgten, dass Auschwitz in Zeiten zunehmender Ost-West-Block-Konfrontation zur bloßen Metapher für die Grausamkeiten von Kapitalismus oder Imperialismus werden sollte. Exemplarisch dafür Hans Magnus Enzensberger, der schrieb, »das Prinzip des Rüstungswettlaufs sei ›nicht weniger paranoid‹ als die Vorstellung der jüdischen Weltverschwörung«.
Selbstverständlich kommt auch die TV-Serie Holocaust zur Sprache, deren weltweite Resonanz Gerber unter anderem mit dem »einsetzenden Siegeszug partikularistischer Ideen« und den aufkommenden Diskursen von »Differenz und Identität« erklärt. Der Historiker erinnert ferner daran, dass 1978, nur wenige Monate nach der Erstausstrahlung der Serie, auch die Bibel der Postkolonialen erschien: Orientalismus von Edward Said.
Damit die »Globalisierung« funktionieren konnte, war eine »Entkernung« notwendig
In diese Phase fällt zugleich der Anfang dessen, was der Autor als die Globalisierung des Verbrechens umschreibt, die zu einem Fallstrick der Erinnerung geworden sei. Gerbers Argument: Auf Gedenktagen und Feierstunden wurden fortan die Bewahrung der Menschenrechte, der Demokratie und Toleranz als Lehre von Auschwitz beschworen. Man versuchte, im Holocaust einen Sinn zu erkennen. »Das klang schön, war aber absurd. Denn um etwas über die Bedeutung von Toleranz, Menschenwürde und individuellen Freiheitsrechten zu erfahren, hätte kein einziger Mensch ermordet werden müssen.«
Damit diese »Globalisierung« auch funktionieren konnte, war eine »Entkernung« des Holocaust notwendig. »Um das Verbrechen als allgemeingültige Chiffre für größtmögliches Leid nutzen zu können, musste ihm seine Besonderheit wieder ausgetrieben werden.« Gemeint ist damit alles spezifisch Jüdische sowie der Antisemitismus als eigenständige Kategorie. Beides fiel sukzessive unter den Tisch.
Nicht zuletzt dank der luziden Sprache, die fast schon feuilletonistisch zu nennen ist, vermittelt Gerber ein Gesamtbild der erinnerungsgeschichtlichen Debatten über das zentrale Verbrechen des Nationalsozialismus, wie man es in dieser Form und Dichte bisher selten gelesen hat.
Jan Gerber: »Das Verschwinden des Holocaust«. Edition Tiamat, Berlin 2025, 336 S., 28 €