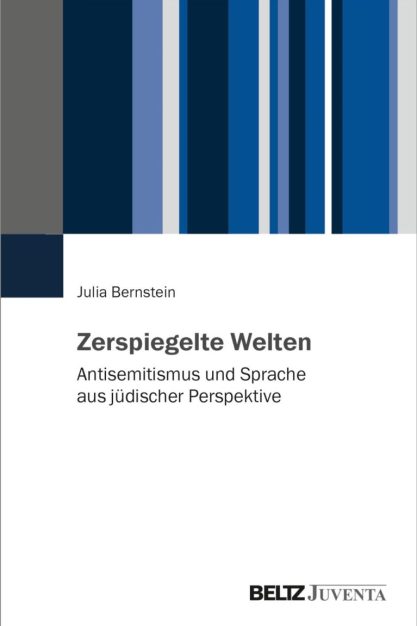Sprache dient uns nicht nur zur (Alltags-)Kommunikation, sie kann ebenso emotionalisieren, mobilisieren – und diskriminieren. Was geschieht, wenn ein und dieselben Formulierungen unterschiedlichste Assoziationen wecken, den einen banal-unterhaltsam erscheinen, den anderen aber Ausgrenzung oder Anfeindung signalisieren?
Dieser schizoiden, letztlich aber gefährlichen Konstellation geht die Soziologin und Antisemitismusforscherin Julia Bernstein in ihrem neuesten Buch Zerspiegelte Welten. Jüdische Perspektiven auf Antisemitismus und Sprache in Bezug auf Deutschland nach.
Der Fachwelt vor allem bekannt als Expertin für Antisemitismus an Schulen, legt Bernstein nun einen recht persönlich gehaltenen Essay vor, als Anregung zum Nachdenken für Juden und Nichtjuden. Doch berührt ihre Analyse auch das unerforschte Feld des latenten Antisemitismus, der bisher noch tief unter dem Radar bisheriger Definitionen und Erkennungsmuster segelt.
Unsicherheit Anknüpfend an Monika Schwarz-Friesels Essay Toxische Sprache und geistige Gewalt (2022), skizziert Bernstein heutige Mechanismen antisemitischer Dämonisierung und Abwertung, erweitert den Blick zugleich auf im Alltag fortwirkende Lexeme aus der NS-Zeit und auf sprachliche Verbiegungen, die sich aus einer grundsätzlichen Unsicherheit gegenüber jüdischen Themen und Personen ergeben.
»Zerspiegelung« bedeutet insofern nicht nur unterschiedliche Sichten auf die Welt und das Zusammenleben von Juden und Nichtjuden in Deutschland, sondern auch eine fortwährende Distanz und Störung in der Kommunikation.
Die Autorin verweist auf eine Vielzahl vermeintlich harmloser Äußerungen im Alltag, die absurde Vorstellungen davon spiegeln, wer Juden »eigentlich« seien, was sie angeblich ausmache und wie man sich möglicherweise zu ihnen positionieren solle.
Dies beginne etwa dort, wo an deutschen Schulen Interesse entwickelt wird, doch mal einen »richtigen« Juden kennenzulernen, oder der (christliche) Religionslehrer freundlich, aber bestimmt darauf beharre, die Schreibweise von »Schabbat« auf »Sabbat« zu korrigieren. Einen kritischen Blick wirft Bernstein auch auf verbale »Echos aus der Vergangenheit«, die sich hierzulande einer merkwürdigen Beliebtheit erfreuen und Gefühlszustände beschreiben sollen – etwa euphorische sportliche Begeisterung als ein »innerer Reichsparteitag« oder »Stress bis zum Vergasen«. Hier und an anderen Stellen wirft Bernstein zwei dringliche Fragen auf: Wie gehen Jüdinnen und Juden aktuell damit um, und wie lässt sich semantische Sensibilisierung noch bewerkstelligen?
stellvertreter Noch komplizierter und »zerspiegelter« wird es, wenn Nichtjuden und Juden in Deutschland einander unerwartet begegnen. Manche Menschen, so Julia Bernstein, würden »sagen, sie hätten noch nie einen Juden gesehen, sie würden Juden lieben, manche entschuldigen sich stellvertretend für alle Deutschen bei jemandem als vermeintlichen Stellvertreter der Juden dafür, ›was ihnen alles passiert‹« sei.
Bernstein ist sich der Grenzen linguistischer Dekonstruktion und Aufklärung wohl bewusst. Ihr neues Buch ist gleichwohl ein engagierter, weiterer Versuch, sensibel zu machen für Worte und Bilder, die Juden und Nichtjuden am Ende gleichermaßen schaden.
Julia Bernstein: »Zerspiegelte Welten: Antisemitismus und Sprache aus jüdischer Perspektive«. Beltz Juventa, Weinheim 2023, 135 S., 20 €