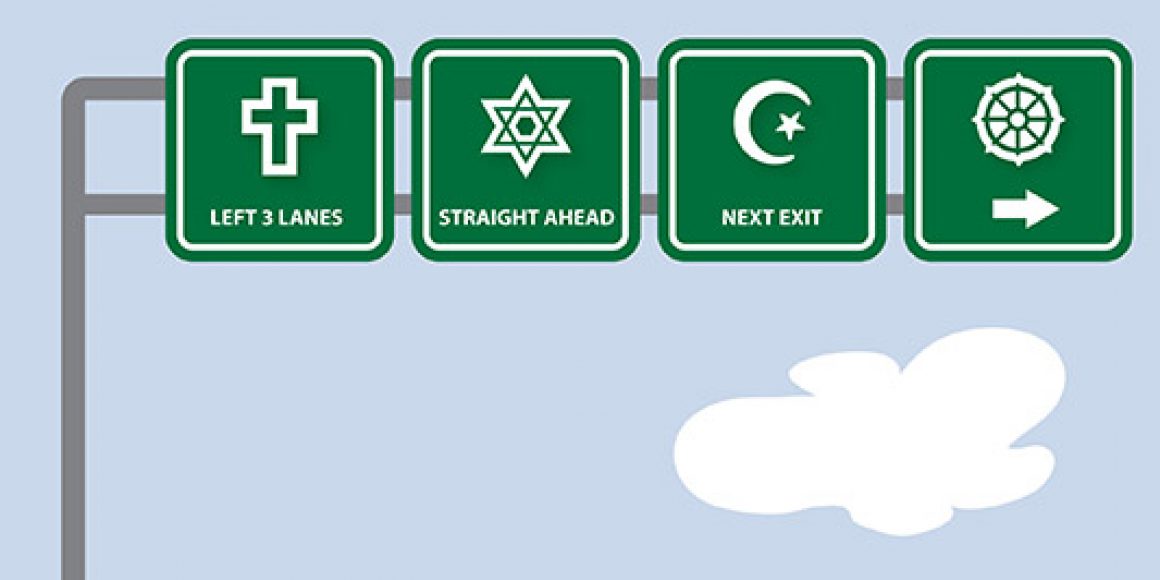Wie viel Vielfalt lassen das Judentum, das Christentum und der Islam zu? Welche religiösen Differenzen tragen die großen Flüchtlingsströme in die Gesellschaft hinein, und wie soll man damit umgehen? Mit diesen Fragen befasst sich ein neuer Forschungsschwerpunkt der Frankfurter Goethe-Universität und der Justus-Liebig-Universität Gießen.
Plötzlich ist Religion auch in Europa wieder eine Frage auf Leben und Tod. Kaum ein Monat vergeht ohne Terrormeldungen und Anschläge radikalisierter IS-Gruppen oder Einzeltäter in Paris, London oder auch Berlin.
In welcher Form akzeptieren die großen Weltreligionen die Meinungen Andersgläubiger? Sind sie überhaupt fähig zu Dialog und Konsens, oder führt Monotheismus unweigerlich zu Gewalt? »Religiöse Positionierung« im Judentum, Christentum und Islam, darum geht es in dem interdisziplinären Forschungsschwerpunkt an der Goethe-Universität, dessen fast 40 internationale Wissenschaftler in diesem Monat ihre Arbeit aufgenommen haben.
Pluralität Der Verbund der Frankfurter und Gießener Universitäten wird vom Land Hessen für vier Jahre mit rund 4,5 Millionen Euro finanziert. Unterstützt wird das Vorhaben aber auch von zahlreichen jüdischen Institutionen wie dem Zentralrat der Juden in Deutschland, der Jüdischen Gemeinde Frankfurt oder der Bildungsstätte Anne Frank. Auch das Amt für multikulturelle Angelegenheiten der Stadt Frankfurt, das Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung oder das Zentrum für Islamische Studien sind mit an Bord.
Die Forscher nehmen das Thema von einer neuen Seite in den Blick. Nicht die Suche nach der harmonisierenden Überwindung von Gegensätzen steht im Fokus. Vielmehr gehen die Wissenschaftler davon aus, dass Religionen grundsätzlich Position beziehen und somit konfliktträchtig sind. »Einwanderungsländer müssen sich auf mehr Pluralität, religiöse Differenzen und auch Ängste einstellen, aber das muss nicht immer grundsätzlich negativ sein«, sagt Christian Wiese, Initiator und Sprecher des Forschungsverbundes sowie Inhaber der Martin-Buber-Professur für jüdische Religionsphilosophie an der Goethe-Universität.
Welche Chancen, welchen Vielklang oder Widerstände bergen diese religiösen Positionierungen? »Das wollen wir in verschiedenen interdisziplinären Projekten durchspielen«, sagt Wiese. Beteiligt sind Philosophen, Theologen, Religionswissenschaftler, Ethnologen, aber auch Soziologen oder Erziehungswissenschaftler. 20 neue Forscher und Wissenschaftler, darunter auch Post-Docs oder Promovierende aus Israel, Syrien und den USA, werden an dem Forschungsverbund bis 2020 mitarbeiten.
Kontakt »Das ist mehr als ein Projekt im Elfenbeinturm. Wir wollen öffentliche Debatten anstoßen, ein Forum für Diskussionen bieten«, kündigt Wiese an. Geplant sind 13 Projekte mit teils historisch-kulturwissenschaftlichen Bezügen, aber auch aktuellen sozialwissenschaftlichen Aspekten. »Unsere Forschung ist sehr nach außen gerichtet. Wir sind nicht nur Bücherschreiber«, betont der Theologe und Judaist.
»Wir stehen in engem Kontakt mit den jeweiligen Gemeinden, mit jüdischen, evangelischen oder katholischen Akademien, mit islamischen Wissenschaftlern oder auch der Universität in Tel Aviv«, nennt er einige Beispiele. Partnerinstitutionen, »die ganz nah dran sind an der Praxis«, sind ihm wichtig. So führt Wiese etwa Gespräche mit der Bildungsabteilung im Zentralrat der Juden, aber auch unmittelbar mit Mitgliedern der Frankfurter Gemeinde.
In einem Projekt will sich der Professor für jüdische Religionsphilosophie unter anderem Fragen der innerjüdischen Pluralität widmen und wie mit den unterschiedlichen Strömungen im Judentum umgegangen wird.
Natürlich ist der islamische Terror ein Thema: Ein Projekt wird sich beispielsweise mit den Möglichkeiten und Grenzen des Dialogs mit Salafisten befassen. Dabei geht es insbesondere um Fragen der Radikalisierung und um die ausgeprägte Salafistenszene in Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet. Andere Vorhaben drehen sich um den Islamunterricht oder die Identität junger Musliminnen. Weitere Themen werden die religiöse Kritik am Kapitalismus sein, die Emotionsforschung oder die Frage, wie etwa christliche Missionare durch andere Kulturen oder Begegnungen in ihrer Positionierung beeinflusst wurden. »Die Vielfalt ist unsere Stärke«, sagt der Sprecher des Forschungsverbundes.
Gewalt Für jedes Jahr sind Themenschwerpunkte geplant. 2018 wird das der religiöse Pluralismus sein, 2019 soll es um Religion und Gewalt gehen. »Das interessiert die meisten«, mutmaßt Wiese. Vorgesehen sind Konferenzen, Ringvorlesungen, Ausstellungen unter anderem in der Jüdischen Gemeinde oder auch Podiumsdiskussionen und Tagungen. Gleichgewichtig soll für alle drei Religionen ein öffentliches Forum geschaffen werden.
»Dabei wird nach vier Jahren sicherlich nicht das eine eindeutige, exemplarische Modell zum Dialog als Ergebnis herauskommen. Das gibt es nicht«, betont Christian Wiese. Aber der Forschungsverband will das Potenzial der Religionen aufzeigen, welche Möglichkeiten sie bieten, mit Vielfalt und Differenzen umzugehen. Ganz konkret soll daraus Unterrichtsmaterial für den Schulunterricht oder Stoff für Vorlesungen entstehen. »Wir wollen Orientierung bieten«, so Wiese.