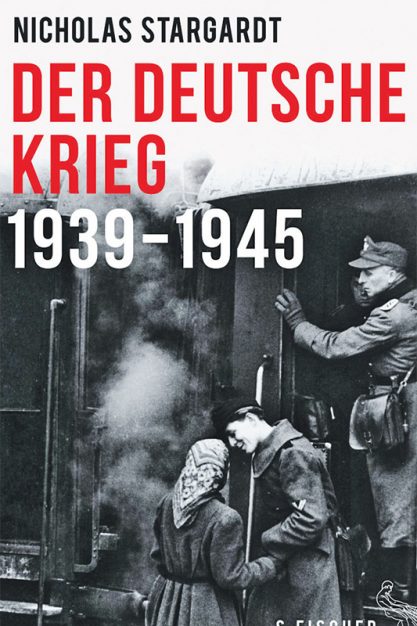Es ist für Nachgeborene schier unbegreiflich, dass die übergroße Mehrheit der Deutschen die fünfeinhalb Jahre des Weltkriegs bis zum Untergang durchlebt hat, ohne sich aufzulehnen. Aber die Deutschen verfuhren genau so. Doch was in ihnen vorging, wie ihr Leben von Zweifeln, Hoffnungen und Ängsten bestimmt wurde, darüber wissen wir nicht viel.
Das kollektive Gedächtnis, wie es Walter Kempowski in den Bänden seines berühmten Werks Das Echolot anhand von ungezählten »Erinnerungskristallen« von Menschen aus dieser Zeit zusammengesetzt hat, folgte der Überlegung, dass die eigene Erinnerung als das Allerprivateste aufs Engste mit dem Allgemeinsten korrespondiert.
Der aus Australien stammende, in Oxford lehrende Historiker Nicholas Stargardt ist ein ausgewiesener Kenner der deutschen Geschichte. Auch ihn hat die Frage beschäftigt: Wie haben die Deutschen diesen Krieg, der von ihrem Regime angezettelt wurde, erlebt, und warum sind sie den Befehlen Hitlers bis zum Schluss und teilweise noch darüber hinaus gefolgt?
Autobiografien Anders als der Dichter Walter Kempowski hat Stargardt autobiografisches Material wie Briefe und Tagebücher nur weniger Personen benutzt, um einen möglichst anschaulichen Eindruck von der Atmosphäre und den Lebensumständen der Kriegsjahre zu gewinnen. Dass es sich hierbei nicht um den Versuch einer repräsentativen Untersuchung handeln kann, liegt auf der Hand.
Und doch gelingt es Stargardt, indem er Vertreter verschiedenster Herkunft und Berufe zu Wort kommen lässt, die Realität der Verhältnisse zu spiegeln. Ins Bild rückt er dabei Offiziere, Bauernsöhne, Akademiker, einfache Soldaten, Katholiken und Protestanten, auch ein paar Prominente, wie Victor Klemperer oder die Berliner Journalistin Ursula von Kardorff, die in den Kriegsjahren den einen oder anderen Juden materiell unterstützte, ihrem Tagebuch aber anvertraute, dass diese Menschen auch einen »gewissen Zuspruch« nötig hätten.
Stargardt bemerkt dazu: »Gelegentliche Hilfe war eine Sache, zu mehr war Kardorff jedoch nicht bereit (...). So sehr sie vielleicht Juden helfen wollte zu überleben, sie wünschte sich keineswegs, dass Deutschland den Krieg verlor.« Mit dieser Haltung stand sie nicht allein. Immerhin weist Stargardt darauf hin, dass »während des Krieges in Deutschland zahlreiche Informationen über den Völkermord kursierten«. Während die deutschen Juden den Krieg unter dem Eindruck des »fortschreitenden Holocaust« (Stargardt) wahrnahmen, beschäftigte die meisten Deutschen das sie unmittelbar betreffende Kriegsgeschehen, die Kämpfe an den verschiedenen Fronten, die immer massiver werdenden Bombardierungen der Städte.
Wehrmacht Erschüttert zeigten sich etliche Wehrmachtsangehörige nach dem Polen-Feldzug über das Vorgehen der SS-Einsatzgruppen gegen die Juden und die polnische Intelligenz. Es herrschte, zeigt Stargardt, anders als 1914 keine Begeisterung in der deutschen Bevölkerung, als die Wehrmacht in Polen einfiel, und es gab weder patriotische Aufmärsche noch sonstige Massenkundgebungen. Die beiden großen Kirchen reagierten unterschiedlich auf den Beginn des Weltkriegs.
Die evangelische Kirche vereinigte sich »auch in dieser Stunde mit unserem Volk in der Fürbitte für Führer und Reich«. Die katholischen Bischöfe hingegen interpretierten »diesen Waffengang als Strafe für den weltlichen Materialismus der modernen Gesellschaft«, so Stargardt.
Die Lektüre dieses gut recherchierten und spannend geschriebenen Buchs hinterlässt freilich auch einen bitteren Nachgeschmack. Etlichen Selbstbekundungen der Protagonisten kann man entnehmen, wie starr sich am Ende eine persönliche Verteidigungshaltung gegenüber den von Deutschen verübten Verbrechen in diesem Krieg behauptete. Schuld waren vielfach die anderen: die Bolschewisten, die Partisanen – und die Juden sowieso. Das eigene Handeln wurde als gerechtfertigt beglaubigt, und es war oft dieses Verhaftetsein in der Katastrophe, das den Umgang der Generationen nach dem Krieg belastete.
Nicholas Stargardt: »Der deutsche Krieg 1939 bis 1945«. S. Fischer, Frankfurt 2015, 848 S., 26,99 €