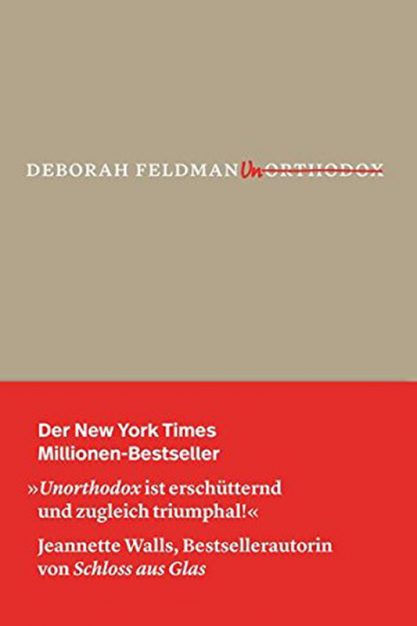Deborah Feldmans Debütroman Unorthodox aus dem Jahr 2012 wurde nach vier Jahren ins Deutsche übersetzt und überzeugt mit bewusster Reduktion aufs Wesentliche: Worte, schonungslos ehrlich, die, anders als in der Originalausgabe, ohne Fotos auskommen. Zu Recht, denn Feldman besitzt die Gabe, mit ihrem Erzählstil gestochen scharfe Momente zu skizzieren. An einigen Stellen so scharf, dass sie wehtun.
Devoireh, Feldmans elfjähriges Ich, ist die erste Berührung mit einer Welt, die kaum Berührung zulässt. Es ist die Welt der Satmarer, einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde im New Yorker Stadtteil Williamsburg, in der die Autorin die ersten 17 Jahre ihres Lebens verbringt. Damit öffnet sie Türen in eine Welt, die nicht nur für Außenstehende geschlossen ist, sondern gerade für Frauen einen Alltag aus Gehorsam, Gesetz und allumfassender Gottesfürchtigkeit darstellt.
wendepunkt Über neun Kapitel wächst der Leser mit Deborah Feldman. Vom schüchternen Mädchen, über einen im Verborgenen aufmüpfigen Teenager, bis hin zum Wendepunkt als junge Mutter, die realisiert, dass Glaube und Wissen manchmal nur wenige Häuserblocks trennen. Eine Reise in dicken, kratzigen Baumwollstrümpfen hinter traditionsgeschwängerte Fassaden, die im Laufe der Geschichte zu bröckeln beginnen. So schwankt man zwischen Empathie für die auf ihre Art bedingungslos liebenden Großeltern und Antipathie gegenüber der Gnadenlosigkeit des göttlichen Diktats.
Gekonnt schafft Feldman den konstanten Sprung zwischen lyrischer und nüchterner Erzählweise. Lyrisch, wenn sie von den geheimen Ausflügen in die Bibliothek erzählt, von ihren mit ähnlichen Schicksalen behaftete Romanheldinnen, mit denen sie sich gedanklich verschwistert. Nüchtern, wenn sie von einer Parallelgesellschaft berichtet, die schwarz-weiß denkt, keine Grauzonen zulässt. Schwarz wie die seidenen Kittel des Patriarchats, blütenweiß wie die Baumwolltücher der Frauen, die ihre Reinheit Monat um Monat unter Beweis stellen müssen. Ungeachtet einer für unser Empfinden so selbstverständlichen Privatsphäre.
Unorthodox ist für den Leser schonungslose Konfrontation mit Emotionen und erkämpften Freiheiten. Man möchte Devoireh in den Arm nehmen, als sie und ihre beste Freundin im hohen Gras der als jüdisches Ferienparadies bekannten Catskills erwischt und mit Unterstellungen konfrontiert werden, die jenseits ihres jugendlichen Verständnisses liegen. Man möchte Wort für sie ergreifen, wenn ihr Umfeld aus Tanten, Cousinen und Nachbarn schweigt. Möchte an einigen Stellen die Türen schließen, das Buch weglegen, durchatmen.
liebe Doch Deborah Feldman macht dies unmöglich – denn im krassen Gegensatz zur Wahrheit mischt sich nicht selten Wehmut unter ihre Sätze. Liebevoll schreibt sie über die zerlebte Küche ihrer Bubbe, der Frau, die sie großzog. Ehrlichen Respekt widmet sie ihrem Großvater, einem weisen Talmudisten, dessen Schwäche immer dann deutlich wird, wenn die Liebe zum Allmächtigen größer als die Liebe zu seinen Nächsten scheint.
Auch wenn ihre Kinderseele bebt, beschreibt Feldman ruhig und besonnen die sukzessive Trennung von morschen, vom Holocaust geschwächten Wurzeln. Wer die unerschöpfliche Kraft des eigenen Willens als spirituelle Redundanz abtut, der wird durch Deborah Feldman und Unorthodox eines Besseren belehrt. Denn auf sich allein gestellt erreicht sie das, was man als höchste persönliche Errungenschaft bezeichnen kann: Sie wird zur Heldin ihrer eigenen Geschichte.
Deborah Feldman: »Unorthodox«. Autobiografie. Übersetzt von Christian Ruzicska. Secession, Zürich 2016, 319 S., 22 €