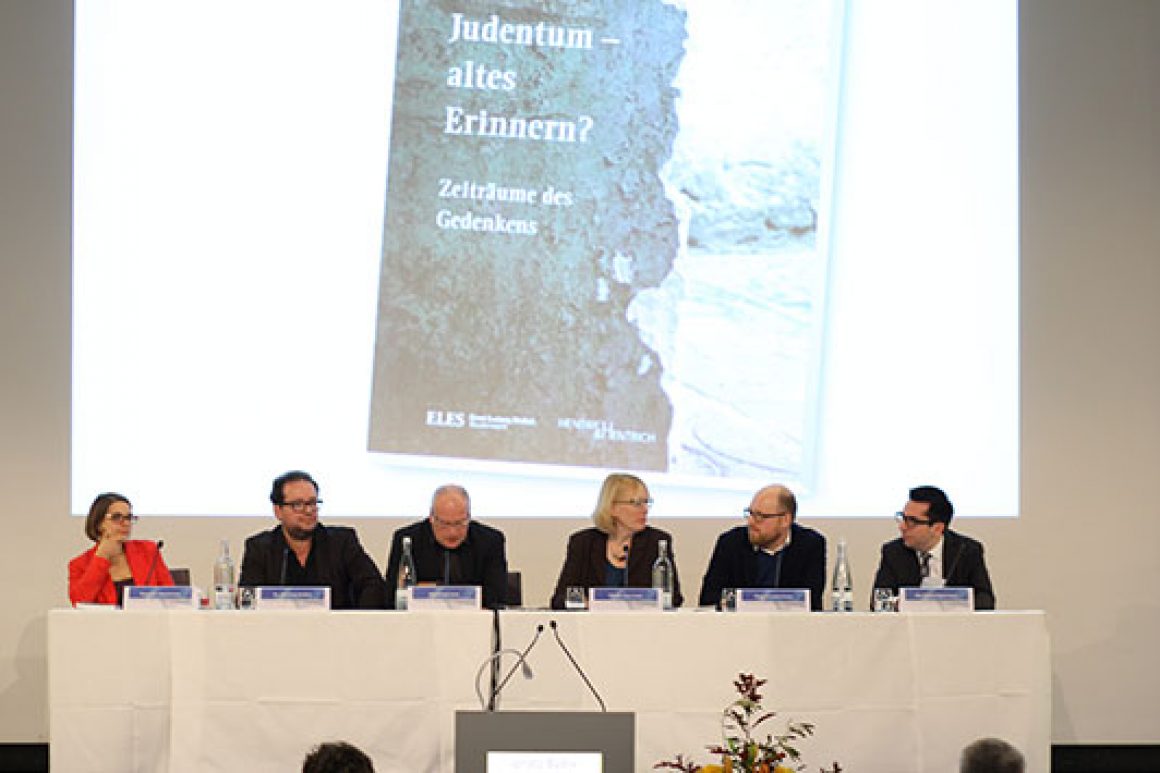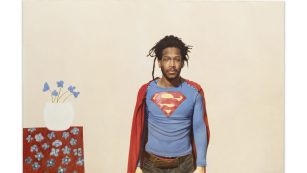Der Duden trifft eine klare Entscheidung: Dem Wörterbuch der deutschen Sprache zufolge bedeutet gedenken, »an etwas ehrend, anerkennend und in einer bestimmten Situation zurückdenken, sich an dessen Existenz erinnern«. Das Erinnern selbst hingegen wird nüchtern als das bloße Faktum definiert, dass man etwas im Gedächtnis bewahrt hat, statt es zu vergessen. Und als Mahnung, wie etwa bei einer »Zahlungserinnerung«, bei einer offenen Rechnung.
Doch wie viel mehr schwingt in diesen beiden Verben mit, vor allem, wenn es um die deutsch-jüdische Geschichte geht! Den Bedeutungshorizont dieser beiden problematischen Wörter zu ermessen, ihren historisch sich permanent verändernden Sinn zu beschreiben und die vielen politischen Motive und Konsequenzen, die mit unterschiedlichen Gedenk- und Erinnerungskulturen verknüpft sind, zu analysieren – das war das Ziel der dreitägigen Konferenz »Geteilte Erinnerung.
Gedenken in der deutschen Gesellschaft – Erinnern in der jüdischen Gemeinschaft«, die die Bildungsabteilung des Zentralrats in der vergangenen Woche in Frankfurt veranstaltete.
Eröffnet wurde die Konferenz am vergangenen Mittwoch mit einem Festakt im Kaisersaal des Frankfurter Römer. Oberbürgermeister Peter Feldmann begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste, darunter Zentralratspräsident Josef Schuster und Vizepräsident Mark Dainow.
Schuster bekannte in seiner Rede, dass er »ein Fan von Gedenkveranstaltungen« sei, weil sie die Möglichkeit des Innehaltens inmitten von Alltagsgeschäften und politischem Betrieb bieten. »Das kulturelle Gedächtnis braucht Rituale, Mahnmale, Jahrestage, wiederkehrende Bilder und auch sprachliche Floskeln, um sich zu bilden, zu bewahren und zu entwickeln«, zitierte Schuster den Autor Navid Kermani.
rituale Wie immer hatten die beiden Verantwortlichen, Sabena Donath als Leiterin und Doron Kiesel als wissenschaftlicher Direktor der Bildungsabteilung, ein anspruchsvolles und vielseitiges Tagungsprogramm zusammengestellt.
Dabei bewegten sich die Vorträge, Lesungen und Diskussionen, so unterschiedlich sie vordergründig erschienen, wie in konzentrischen Kreisen um ein gemeinsames Zentrum: um die Frage, wie vor allem innerhalb der jüdischen Gemeinschaft adäquate, alle unterschiedlichen Gruppen mit einbeziehende Formen des Gedenkens an die Schoa gefunden werden können.
Denn die Definition, dass »Gedenken« ein öffentliches, auf ein festgelegtes Datum beschränktes Ritual sei, während »Erinnern«, wie Kiesel in seiner Rede im Römer ausführte, per se als »jüdisches Handeln« zu gelten habe, als eine Einstellung oder Haltung, die die Geschichte des eigenen Volks und Gottes Eingreifen in dieselbe wachhält, erfasst nicht alle Facetten.
Gorelik Unterricht Das wurde vor allem in dem sehr offen geführten Gespräch deutlich, das Sabena Donath mit der Schriftstellerin Lena Gorelik führte. Gorelik, geboren 1981 in Sankt Petersburg, kam mit elf Jahren als »Kontingentflüchtling« nach Deutschland.
Erst hier, im Schulunterricht, erfuhr sie von dem Mord an sechs Millionen Juden während der Schoa: »Ich kam als Sieger nach Deutschland – und plötzlich war ich Opfer«, beschreibt sie die Erschütterung, die dieses Wissen bei ihr auslöste. »Fortan begann ich alles, was ich nur finden konnte, über den Holocaust zu lesen; ich war wie besessen von dem Thema«, erinnert sie sich.
Aber während für Sabena Donath als »Alteingesessene« im Land der Täter die Schoa identitätsstiftend war, lehnt Gorelik dies kategorisch für sich ab: »Jeder, wenn er nur ein menschliches Herz besitzt, kann ermessen, welcher Verrat an der Menschlichkeit mit dem Mord an sechs Millionen Juden begangen wurde. Dass sich das niemals wiederholen darf, haben wir alle gespeichert, unabhängig davon, ob wir Juden sind oder nicht, und auch nicht nur an einem Tag und indem wir Kränze niederlegen.«
Schoa Auch der Soziologe Natan Sznaider arbeitete in seinem brillanten Vortrag die Differenz zwischen einer »jüdisch-diasporischen« und einer »israelisch-souveränen« Reaktion auf die Erfahrung der Schoa heraus.
Während Zionisten und Gründer des israelischen Nationalstaats das »Nie wieder!« um den Zusatz »wir« ergänzten und sich demzufolge ihre Solidarität und ihr Mitgefühl ausschließlich auf das eigene Kollektiv konzentrierte, dessen Sicherheit zu wahren zur obersten Staatsräson erklärt wurde, werden in jüdischer Perspektive die eigenen leidvollen Erfahrungen zur Begründung einer universellen humanitären Ethik, ganz so, wie es in der Tora heißt: »Ihr wisst doch selbst, wie einem Fremden zumute ist.« Im offiziellen israelischen Sprachgebrauch gelten Flüchtlinge als »Infiltranten«.
Allein dieses Beispiel veranschauliche die »Macht der Erinnerung und ihren Einfluss auf eine Gemeinschaft«, sagte Sznaider. Dass gleichzeitig so unterschiedliche Beschreibungen und Deutungen der einen Wirklichkeit nebeneinander existierten, sei das, was eine moderne Gesellschaft ausmache, so Sznaider weiter: »In dieser Hinsicht ist Israel wesentlich moderner als die Bundesrepublik.«
zusammenführung Diesem Konzept stellte Doron Kiesel seine Gedanken gegenüber, wie sich jüdisches Erinnern und deutsches Gedenken zusammenführen ließen. In der Tora werde das Wort »erinnern« 169-mal gebraucht: »Dem Volk Israel wird eingeschärft, nicht zu vergessen, sondern sich der Geschichte und des eigenen Leidens und Überlebens als Minderheit permanent bewusst zu sein«, so Kiesel.
Insofern bedeute Erinnern immer auch Trauern: »Die deutsche Mehrheitsgesellschaft ist dann anschlussfähig, wenn sie sich darauf schmerzlich einlässt«, betonte Kiesel.
Ein treffendes Resümee der Tagung zog der Geschäftsführer des Zentralrats, Daniel Botmann. Er wies darauf hin, dass die jüdische Gemeinschaft durch die Zuwanderung gelernt hat, dass es auch unterschiedliches Erinnern geben kann, das auch nebeneinander stehen und sich ergänzen kann. »Weder muss es eine eindeutige Antwort darauf geben, wer wir sind, noch darauf, was das Erinnern sein müsse«, so Botmann.
»Immer aber sollten wir darüber reden. Wir Juden untereinander. Alte und Junge. Zuwanderer und Alteingesessene. Gedenkkultur ist kein abgeschlossener Prozess. Gedenkkultur ist auch nichts Statisches, sondern im besten Fall ein Prozess fortlaufender kritischer Reflexion.«