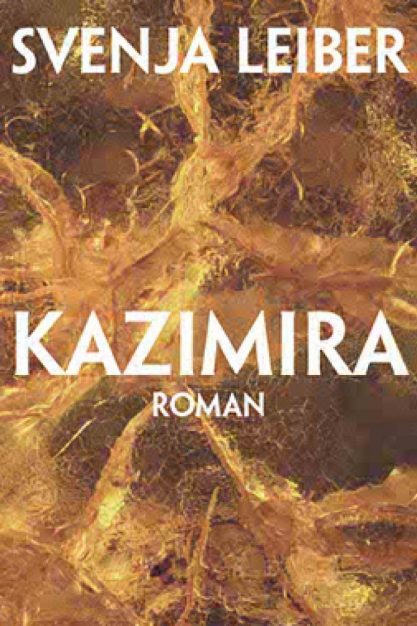Eine wie sie gab es vielleicht noch nie in der Literatur. Kazimira ist groß, schmal, folgt ihren Instinkten und kennt nur wenige Worte. Das Meer, der Wind, der Bernstein sind ihr näher als die meisten Menschen. Sie stört die Geschlechterordnung, schneidert sich Hosen, schneidet sich den Zopf ab. Sie will »kein Kindchen«: »Ihr schien allein gewiss, dass das, was die anderen sättigt, bei ihr nur Hunger erzeugt.« Der Geruch, der Hals, die Haut einer Frau werden ihren Hunger stillen und nähren.
Kazimira in ihrer kleinen, dunklen Hütte am Ostseestrand ist Zeugin mörderischer Zeitläufte. Weil ihr Mann Antas ein kundiger Sammler ist, wird in den sandigen Boden am Meer eine tiefe Grube gebohrt; Bernstein, das fossile Harz, ist Gold wert. Die Grube gehört dem jüdischen Unternehmer Hirschberg, dessen Geschäfte seine Frau Henriette im Hintergrund so klar- wie vorsichtig lenkt. Treitschkes Satz von 1879 »Die Juden sind unser Unglück« wird in ihrem Haus aufgewühlt diskutiert, lange bevor die Hirschbergs fliehen müssen.
weltkriege Zwei Weltkriege verwandeln die Region in »Bloodlands«. Kazimira erlebt noch, wie ihre Urenkelin Jela, ein unersättlich lebenshungriges Kind mit großen Augen, in eine »Heil- und Pflegeanstalt« verbracht wird und nie wiederkehrt. Doch die Mädchen und Frauen in diesem Roman bleiben im Gedächtnis. 16 Jahre nach ihrem Debüt, dem Erzählungsband Büchsenlicht, und nach den drei Romanen Schipino, Das letzte Land und Staub gelingt Svenja Leiber das Kunststück, die Schichten der Geschichte eines wenig beachteten Winkels Europas auszuleuchten und dabei ganz gegenwärtige Gesichter, poetische Landschaftsbilder und verschüttete Verbindungen bis in die Gegenwart sichtbar zu machen.
Svenja Leiber findet für die Echos der Geschichte Worte und Sätze, die mitunter schillern wie Bernstein im Licht.
Der historische Hintergrund: Im Januar 1945 wollten die Nationalsozialisten Tausende jüdische Frauen und Mädchen, Überlebende des Todesmarsches aus dem ostpreußischen Außenlager des KZs Stutthof, in der einst »jüdischen« Bernsteingrube »Anna« einmauern. Als der Plan misslang, trieben sie mindestens 3000 Menschen auf die gefrorene Ostsee und erschossen sie. Svenja Leiber weiß, dass diesem Horror literarisch nicht beizukommen ist. Sie weiß aber auch, was mit Faulkner einige Schriftstellerinnen wissen: »Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen«, und sie erzeugt erzählend Leben, als hätte sie’s auf ihren Recherchen an der Küste westlich von Kaliningrad dem Meer, dem Wind, dem Bernstein abgelauscht.
Das liest sich leichter und unterhaltsamer, als es hier klingt, nicht nur, weil die Autorin verschiedenste Stimmen und Stimmungen beherrscht, mal schnoddrig schnell, mal pointiert detailverliebt erzählt; sie wechselt auch kühn und gekonnt Zeit und Raum. Die Vergangenheit der Bernsteingrube von 1871 bis 1945 schneidet sie gegen Szenen einer Liebe in Jantarnyj 2012. In der heutigen Stadt, deren russischer Name klingt, als wäre sie ganz aus Bernstein, verfällt die einstmals größte Bernsteingrube der Welt.
bordell Das Werkstattgebäude fungiert als Bordell, »bei dem ein paar Soldaten herumstehen«. Die Landschaft sieht aus, »als sei der Krieg dort erfunden worden«. (Und der nächste, in der Ukraine oder anderswo, steht schon bevor.) In Jantarnyj würde die Bernsteinverkäuferin Nadja lieber Bagger fahren als Schmuck an deutsche Touristinnen verkaufen, deren Blicke sie »reglos erwidert, bis die deutschen Augen kapitulieren«. Es wundert kaum, dass Nadja, mit so scharfen Sinnen ausgestattet wie Kazimira, aus dem Tagebau merkwürdige Töne hört, eine Art »Raunen«. Das Wort »Raunen« verwendet sie nur mangels besserer Worte.
Svenja Leiber aber findet für die Echos der Geschichte Worte und Sätze, die mitunter schillern wie Bernstein im Licht. Das »lamettert für Sekunden golden« und fängt eine Vergangenheit ein, die nicht vergeht.
Svenja Leiber: »Kazimira«. Suhrkamp, Berlin 2021, 366 S., 24 €