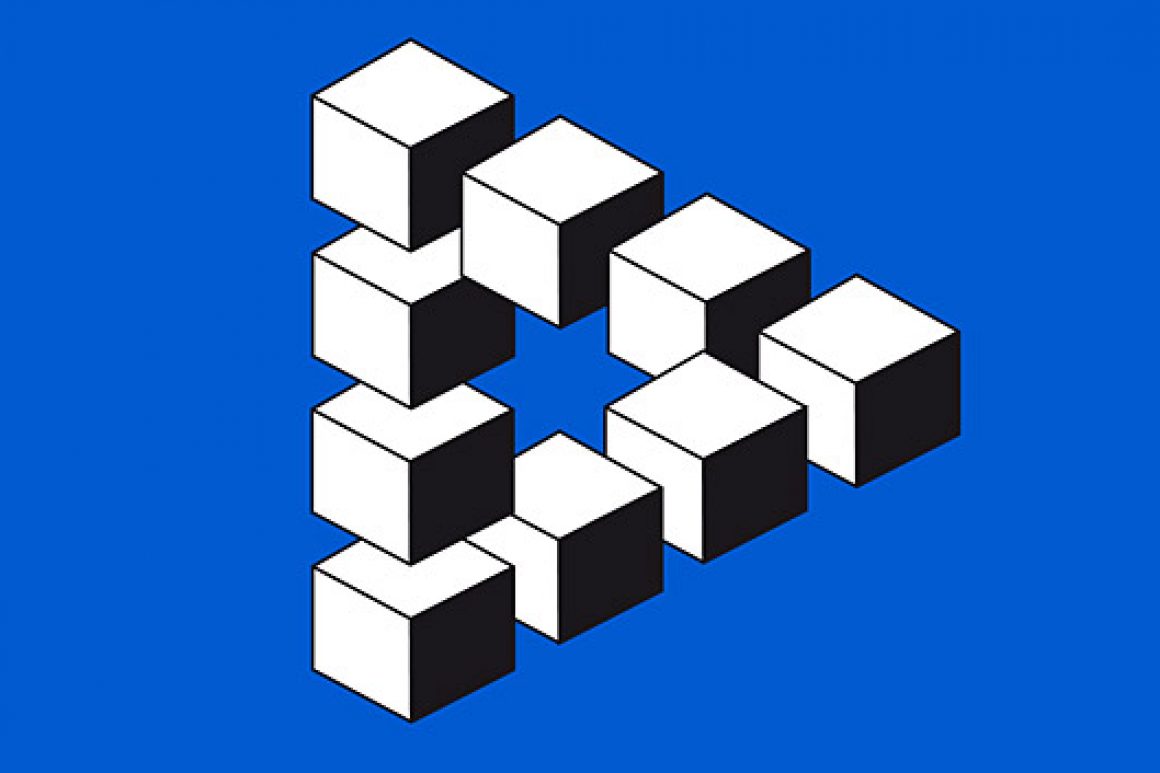Als der Schauspieler Mel Gibson vor einigen Jahren einen Polizisten bei einer Verkehrskontrolle als »Scheißjuden« beschimpfte, beteuerte er hinterher zerknirscht, er sei kein Antisemit, nur der Alkohol sei schuld an seinen Ausfällen gewesen.
Studenten, die beteuerten, keine Rassisten zu sein, wurde in psychologischen Experimenten nachgewiesen, dass sie auf Fotos von Schwarzen negativer reagierten als auf Fotos von Weißen. Allesamt Heuchler, die nach außen eine politisch korrekte Fassade wahren, während ihr inneres, wahres Selbst insgeheim Juden und Schwarze hasst?
Mel Gibson Der Neurowissenschaftler David Eagleman bietet in seinem neuen Buch Inkognito. Die geheimen Eigenleben unseres Gehirns eine andere Erklärung an: »Könnte es nicht sein«, fragt Eagleman, »dass ein Teil von Mel Gibsons Gehirn rassistisch ist und ein anderer nicht?«
Denn, so seine These: Das menschliche Gehirn besteht aus mehreren Untereinheiten oder Subsystemen, die voneinander unabhängig agieren und deren Tätigkeit dem Bewusstsein größtenteils verborgen bleibt. So etwas wie ein einziges »wahres Gesicht« gibt es nicht. Das Bewusstsein dient lediglich dazu, die verschiedenen Subsysteme zu koordinieren, wenn sie miteinander oder mit der Außenwelt in Konflikt geraten.
»Über die meisten unserer Handlungen, Gedanken und Empfindungen haben wir keine Kontrolle«, schreibt Eagleman. »Unser Bewusstsein – das ›Ich‹, das den Motor anwirft, wenn wir morgens aufwachen – macht nur den kleinsten Teil dessen aus, was in unserem Gehirn abläuft.« Das Bewusstsein vergleicht er mit einem Vorstandsvorsitzenden, der seine Firma nach außen repräsentiert, deren einzelne Abteilungen aber autonom arbeiten.
justiz Das hat weitreichende Konsequenzen für unser Verständnis von Willensfreiheit und Verantwortung. Und es erklärt, warum wir innere Konflikte erleben: Ein Teil von uns will Diät halten, ein anderer Teil die Sahnetorte essen. Ein Teil will der Ehefrau treu sein, ein anderer ein erotisches Abenteuer erleben.
Wie wir uns jeweils entscheiden, so der Autor, hängt nicht so sehr von unserem Willen ab, sondern vielmehr davon, welche Gehirnregion die Oberhand gewinnt – das limbische System, das Bedürfnisbefriedigung will, oder der Frontallappen, der für Impulskontrolle zuständig ist.
Der 40-jährige Wissenschaftler, der das »Laboratory for Perception and Action and the Initiative on Neuroscience and Law« am Baylor College of Medicine im texanischen Houston leitet, zieht aus seinen wissenschaftlichen Erkenntnissen aber auch folgenreiche Schlüsse für Justiz und Strafrecht.
So plädiert er in seinem Schlusskapitel dafür, dass beim Umgang mit Straftätern weniger der Strafgedanke im Vordergrund stehen solle, sondern ein neurologisches Training, das den Delinquenten helfen soll, eine bessere Impulskontrolle zu erlangen und somit keine weiteren Verbrechen zu begehen.
Sind Verbrechen und Moral also nichts anderes als Ergebnis bestimmter Schaltungen im Gehirn? Was soll mit Tätern geschehen, die sich ganz rational für das Böse entscheiden? Was ist mit dem legitimen Bedürfnis der Opfer und der Gesellschaft nach Vergeltung? Solchen Fragen weicht der Hirnforscher aus.
Prosa Fachidiot ist Eagleman dabei nicht. Seit Jahren beschäftigt er sich mit Phänomenen wie Zeitwahrnehmung, Synästhesie und optischen Täuschungen, erforschte den Stammbaum seiner jüdischen Vorfahren in Osteuropa und schrieb literarisch-philosophische Kurzgeschichten, die er in dem Band Fast im Jenseits veröffentlichte.
Eaglemans literarisches Talent spürt man auch bei der Lektüre von Inkognito. Das Buch ist ein glänzendes Beispiel für amerikanische populärwissenschaftliche Prosa, die komplexe Sachverhalte anschaulich und unterhaltsam präsentiert.
Bei seiner Tour de force durch die Hirnforschung läuft Eagleman dabei manchmal Gefahr, den Leser zu unterfordern – etwa wenn er die Funktionsweise des Sehens mit optischen Täuschungen illustriert, die wirklich jedes Grundschulkind schon dutzendfach gesehen hat. Alles in allem eröffnet sein Buch aber erstaunliche Perspektiven und wirft erkenntnistheoretische, rechtliche und moralische Fragen auf, die ein einziges Buch ohnehin nicht beantworten kann.
David Eagleman: »Inkognito. Die geheimen Eigenleben unseres Gehirns«. Campus, Frankfurt/Main 2012, 328 S., 24,99 €