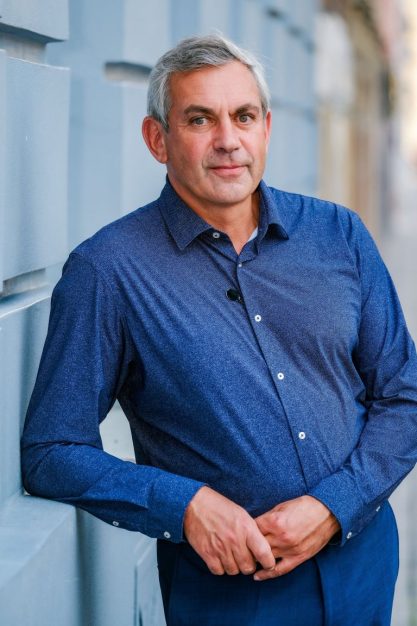Herr Kaminer, Sie haben für den TV-Sender 3sat Deutschland, Österreich und die Schweiz bereist und ließen sich das Brauchtum der Länder zeigen. Sind Traditionen heute überhaupt noch gefragt?
Absolut. Ich war auch überrascht, wie sehr die Menschen an ihren Traditionen hängen. Ich habe mir diese Vielfalt längst nicht so bunt und breit vorgestellt, sondern dachte mir, Bräuche erfolgen immer nach dem gleichen Muster: lustige Klamotten tragen, Bier trinken und irgendetwas am Schluss anzünden. Viel Alkohol fließt zwar wirklich fast immer, aber zumindest auf unterschiedliche Art und Weise.
Worin liegen die Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz?
Bei oberflächlicher Betrachtung ist natürlich die Sprache das verbindende Element. Aber mich interessieren viel mehr die Unterschiede. So wurde mir bald klar, dass man in Deutschland endlos lange Feste feiert, sich in Österreich den ganzen Winter hindurch von Ball zu Ball tanzt und dass die Schweiz ein naturverbundenes Volk ist, das bei jedem Fest - ganz, ganz wichtig – ein Pferd oder eine Kuh nimmt. Der Unterschied zwischen Stadt und Land wird dabei auch deutlich – je mehr wir uns von der Stadt entfernen, desto verrückter die Bräuche.
Was ist das Skurrilste, worauf Sie während ihrer Spurensuche gestoßen sind?
Ganz klar das »Dreckschweinfest«, das man in einem Dorf in Sachsen-Anhalt feiert, um den Winter zu vertreiben. Da springt ein ganzes Dorf in ein Schlammloch. Weiß Europa, dass es dieses Fest gibt? Ich vermute nein. Wozu sich die Menschen alles hinreißen lassen, aber es gehört zu ihrer Tradition.
Vermitteln Traditionen und Bräuche den Menschen nach wie vor das Gefühl von Sicherheit und Stabilität oder ist diese Idee ein Klischee?
Meiner Erfahrung nach hängen die Menschen sehr stark an Traditionen. Aber das ist ja auch nicht weiter verwunderlich ...
Wie meinen Sie das?
Wir leben in einer Zeit, in der die schlechten Nachrichten permanent über unseren Köpfen ausgeschüttet werden. Wir alle sind ständig den Nachrichtenströmen ausgesetzt, was alles auf der Welt geschieht. Uns erreicht das fast rund um die Uhr. Das macht etwas mit uns. Ich nenne es die Marzipan-Gesellschaft, die Glühwein trinken will und das Üble, das auf der Welt geschieht nicht ständig ertragen kann ...
... Brauchtum und Heimat als spezielle Form des Eskapismus?
Ja. Als ich vor Kurzem auf Lesereise war, kamen zwei ältere Herren auf mich zu und meinten: »Bitte erzählen Sie nichts vom Krieg. Wir wollen lachen.« Das sagt doch letztlich alles.
Sie sprechen die Globalisierung an. Benötigt Europa tatsächlich noch so viel Tradition oder wäre es an der Zeit für Veränderung?
In einer globalisierten Welt nehmen Unterschiede immer mehr an Bedeutung an. Schauen Sie sich unsere Innenstädte an: Jede Ladenmeile gleicht der anderen. Da spielen Bräuche nicht die letzte Rolle. Es ist eine Auszeichnung, einen skurrilen Brauch, eine alte Tradition zu leben. Und offenbar funktioniert dieses Muster des sich immer Wiederholenden bis heute. Gewisse Bräuche überdauern Kriege und Jahrhunderte. Tendenziell sind es auch die älteren Menschen, die dafür auch empfänglicher sind. An gewissen Orten lassen selbstverständlich auch jüngere Menschen ihre Traditionen hochleben.
Europa steht derzeit auf wackeligen Beinen. Der Nahe Osten brennt, die Kräfte der Ukraine drohen zu erschöpfen und die Regierungen Deutschlands und Frankreichs sind gelähmt. Was macht Europa falsch?
Vermutlich alles. Bei uns wird alles bis ins kleinste Detail diskutiert, was schnelle Entscheidungen verhindert. Aber es lässt die demokratische Struktur unseres Kontinents am Leben, selbst wenn der politische Betrieb dadurch teilweise ausgebremst wird. Europa ist ein großer Flickenteppich, das ist sein größter Makel - und zugleich sein größter Vorteil.
Wie kommt Europa Ihrer Meinung nach wieder aus dem Krisenmodus heraus?
Dieser politische Zickzack-Kurs, mal links, dann rechts, dann wieder links, verlangsamt wie gesagt das Vorwärtskommen der Demokratien. Ist man von der Regierung enttäuscht, wählt man den anderen Kurs. Aber es ist immer noch besser als ein autokratisches System wie in Russland.
Rechtsnationale Kräfte werden in Europa zunehmend stärker. Wie nehmen Sie das rechtsextreme Gesicht Europas wahr?
Ich begegne immer wieder Menschen, die rechte Parolen rufen. Aber ich sehe darin nichts Politisches. Diese Leute versprechen den Wählern das Blaue vom Himmel, aber das ist populistisch. Und kaum sind sie an der Macht, verlieren sie ihre Radikalität und regieren wie alle anderen auch. Und auch sie schaffen es nicht, die großen Probleme zu lösen.
Also doch Vielfalt feiern und Kulturen vereinen? Wäre das das Zauberwort für Europa?
Ich wäre gern ein Zauberer. Aber was vielleicht helfen würde, die Menschen einander wieder näher zu bringen, wäre wenn man ihnen sagen würde »Entspannt euch!«. Denn es hilft nichts, immer neue Regeln aufzustellen, wir können auch den Klimawandel nicht aufhalten oder die Zuwanderung zurückdrängen. Also was hilft es uns, den Anspruch zu haben, alle Probleme unserer Gesellschaft lösen zu wollen? Unserem politischen Vokabular fehlt der Ausdruck des Nicht-Lösbaren. Also müssen wir damit klarkommen und realistisch genug sein, uns der Situation, wie sie ist, anzupassen.
Mit dem Schriftsteller sprach Nicole Dreyfus.