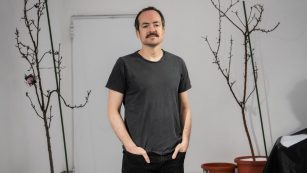Seit mir vor gut einem Jahrzehnt beim Bremer Festival »Poetry on the Road« Tuvia Rübners tiefe, ruhig-warme und auf merkwürdige Weise fremd-vertraute Stimme erstmals in die Ohren geriet, ist mir ihr Echo im Kopf geblieben. Auch jetzt, da ich den soeben im Aachener Rimbaud-Verlag rechtzeitig zum heutigen 90. Geburtstag des Dichters erschienenen Lyrikband Wunderbarer Wahn aufschlage, höre ich diese unverwechselbare Stimme gleich wieder, ihr ganz spezielles Timbre, in dem etwas Vergangenes bewahrt ist.
Etwas, das der 17-Jährige mitgenommen hat, als er 1941 seine Heimatstadt Pressburg verließ, um sich über Ungarn, Rumänien, die Türkei, Syrien und den Libanon durchzuschlagen nach Palästina, in den Kibbuz Merchavia, wo er seitdem lebt. Und wo ihn dann über das Rote Kreuz im Juli 1942 die letzten Nachrichten von seiner Familie erreichten, den Eltern und der geliebten, damals 13 Jahre alten Schwester Alice, die ermordet wurden in Auschwitz, wie die Großeltern und anderen Verwandten, wie die Schulfreunde und Nachbarn.
schafhirte Im Kibbuz, zu dessen Bewohnern vorübergehend auch Golda Meir zählte, hat der spätere Professor für hebräische und deutsche Literatur als Schafhirte gearbeitet und weiterhin, wie schon vor seiner Flucht, Gedichte geschrieben, in deutscher Sprache zunächst, auch dann noch, als der junge Chawer im Alltag kaum mehr Gelegenheit fand, sie zu benutzen. Dass er später einmal, in seiner zweiten, der erlernten Sprache, dem Iwrit, zu einem der bekanntesten Lyriker seines Landes, zu einem preisgekrönten Meister der hebräischen Moderne werden sollte – wer hätte das ahnen können?
Und wahrscheinlich nicht einmal er selbst hätte es für möglich gehalten, dass ihm, als immerhin schon 66-Jährigem, eine literarische Rückkehr in die Muttersprache vergönnt sein würde durch die tatkräftige Hilfe der israelischen Übersetzerin Efrat Gal-Ed und des deutschen Lyrikers Christoph Meckel, die 1990 im Piper Verlag unter dem Titel Wüstenginster einen Band ihrer gemeinsam erarbeiteten Übertragungen von Gedichten Tuvia Rübners vorlegten.
Seit dieser Pioniertat ist Rübner mit seinen im Rimbaud-Verlag publizierten Gedichten und autobiografischen Schriften präsent im deutschen Sprachraum, wenn auch längst nicht so bekannt, wie er es verdient hätte und wie man es dem kleinen rührigen Verlag wünschen möchte.
brücken Tuvia Rübner ist einer der ganz wenigen heute noch kreativen und tätigen Dichter des Exils. Einer, der auch als Übersetzer Brücken baute: Goethe, Celan und Kafka hat er seinen israelischen Landsleuten zugänglich gemacht, während die deutschsprachige Welt ihm ihre Begegnung unter anderen mit dem Nobelpreisträger Samuel Josef Agnon verdankt.
Vor zwei Jahren, in seiner Laudatio bei der Verleihung des Literaturpreises der Konrad-Adenauer-Stiftung an Tuvia Rübner, nannte Adolf Muschg seinen Dichterfreund einen Befreier unserer Sprache, weil er gegen das Unheil und Unglück des 20. Jahrhunderts an ihr fortgeschrieben hat. In nahezu jedem Interview, das mit ihm geführt wird, muss Rübner Stellung beziehen zum Thema Sprache.
Und immer wieder ist dann zu lesen oder zu hören, wie schwierig, ja, wie unmöglich es ist, eine Rangfolge festzulegen zwischen der mitgebrachten, immer noch nahen alten und der vor über 70 Jahren neu erlernten Sprache. Beide, hat Rübner gesagt, empfinde er als Heimat. Doch in seiner Weimarer Dankesrede vor Gästen der Adenauer-Stiftung hat er verraten, welche von allen ihm die wichtigste, die entscheidende ist: »Ich schreibe Gedichte immer noch. Sie sind meine Sprache.«
widerspruch »Ohne das Schreiben von Gedichten«, teilt Tuvia Rübner im Nachwort zu seinem neuen Lyrikband mit, der ausschließlich Gedichte enthält, die er in seinem 88. und 89. Lebensjahr verfasst hat, »wäre ich wahrscheinlich in meinem Morast versunken.« Gedichte als Überlebensmittel, als Ort der Erinnerung, als Totentafeln, als Stätte der Trauer und des Jubels zugleich: »Wunderbar, dass du am Morgen lebend erwachst und wunderbar, dass dein Körper dieses Alter erreicht hat.«
Ja, es ist wunderbar, sagt der Gratulant und lässt sich keinesfalls abschrecken durch die Bemerkung des Dichters im Nachwort: »Es ist mein letztes Buch.« Denn an anderer Stelle, in einem Gedicht – wo denn sonst? – liefert der nun 90-jährige Dichter höchstpersönlich das Geggengift: »Finde selbst tausend Gründe mir zu widersprechen.« Das sei ihm gewünscht und uns.