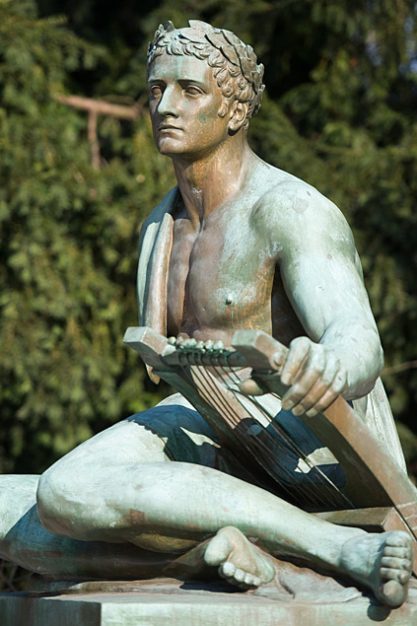Zu Juden fiel ihm nichts ein. Oder doch? Am 4. März wird staatsoffiziell und bundespräsidial das Kleist-Jahr eröffnet. 200 Jahre ist es her, dass Heinrich von Kleist und seine Geliebte Henriette Vogel am Kleinen Wannsee in Berlin Selbstmord begingen. Ein passendes Ende, war der Dichter doch von Tod, Gewalt und Grausamkeit geradezu besessen. Mord, Vergewaltigung, Kannibalismus, Krieg sind die Motive, die sich durch Kleists gesamtes dramatisches Werk ziehen. Diese Faszination durch Gewalt wurde zum politischen Sprengstoff, als sie sich mit Nationalismus verband.
Nach der Niederlage Preußens gegen Napoleon dichtete Kleist vaterländische Verse, in denen er lustvoll zur Vernichtung der »Franzmänner« aufruft: »Dämmt den Rhein mit ihren Leichen«, heißt es in der Ode »Germania an ihre Kinder«. Und in dem Drama »Die Hermannsschlacht« von 1808 sollte der Kampf des Germanenführers Arminius gegen die römische Besatzung als Vorbild dienen, wie mit Napoleons Franzosen zu verfahren sei. »Einen Krieg ... will ich / Entflammen, der in Deutschland rasselnd, / Gleich einem dürren Walde, um sich greifen, / Und auf zum Himmel lodernd schlagen soll.«
Uraufgeführt wurde das Stück erst 50 Jahre nach Kleists Tod. Der Historiker Heinrich von Treitschke (»Die Juden sind unser Unglück«) hatte sich für eine Aufführung starkgemacht. Die Inszenierung in Dresden wurde ein Erfolg dank des Hauptdarstellers Bogumil Dawison – ein polnischer Jude. In der Nazizeit war die »Hermannsschlacht« das meistgespielte Stück von Kleist.
nationalismus Bei allem Hass, ja Vernichtungswahn gegen die Franzosen, findet sich bei Kleist kein Wort über die Juden. Man könnte mit Grund einwenden, der Antisemitismus sei im deutschen Frühnationalismus ohnehin immer mitgemeint gewesen. Doch andere Nationalromantiker wie Fichte, Arndt oder von Arnim versäumten es nie, speziell die Juden mit Hass zu bedenken.
Eben jener Achim von Arnim gründete 1811 in Berlin die »Christlich-teutsche Tischgesellschaft«, die Juden explizit ausschloss. Kleists Mitgliedschaft dort galt lange Zeit als Beleg für seinen Antisemitismus. Doch es ist umstritten, ob er der Gruppe wirklich je angehörte. Die Behauptung, Kleists kurzlebige »Berliner Abendblätter« seien das Organ der Tischgesellschaft gewesen, stammt aus einem Buch des antisemitischen Literaturhistorikers Reinhold Steig von 1901. Steig versuchte darin, Kleist gegen Angriffe seines Zeitgenossen, des jüdischen Aufklärers Saul Ascher, in Schutz zu nehmen. Der hatte die »Abendblätter« wiederholt wegen deren reaktionärer Tendenz kritisiert.
1936, auf dem Höhepunkt der nationalsozialistischen Kleist-Begeisterung, machte der frühere »Weltbühne«-Autor Kurt Kersten in der damals noch erscheinenden »Jüdischen Revue« Kleist gegen den Zeitgeist zum Fürsprecher der Juden. Der Schriftsteller sei 1809 in Prag, wohin er vor Napoleon geflohen war, vom Anblick des Ghettos tief beeindruckt gewesen, schrieb Kersten. Kleist habe sogar eine gedankliche Parallele zwischen der Zerstörung Jerusalems durch die Römer und der Niederlage Preußens gegen die Franzosen gezogen: »Was! Dieser mächtige Staat der Juden soll untergehen? Jerusalem, die Stadt Gottes, von seinem leibhaftigen Cherubime beschützt, sie sollte, Zion, zu Asche versinken?« Germania und Zion als Schwestern – das wäre einem Mitglied der teutschen Tischgesellschaft sicher nicht eingefallen.