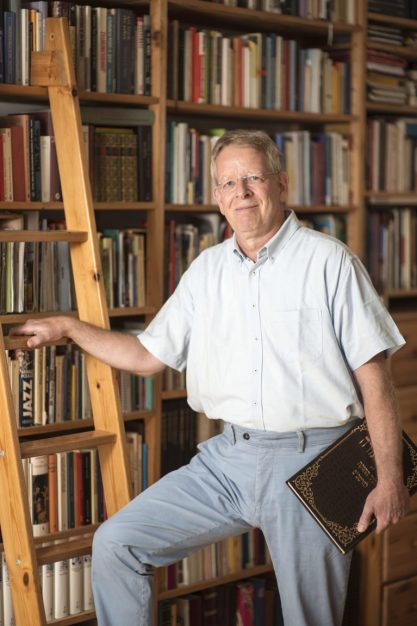Herr Schulte, an der Universität Potsdam gibt es die Jüdischen Studien und die School of Jewish Theology, die bis vor Kurzem von dem umstrittenen Rabbiner Walter Homolka geleitet wurde und zusammen mit dem Abraham Geiger Kolleg (AGK) für die Ausbildung liberaler Rabbiner zuständig ist. Können Sie uns die Entstehungsgeschichte der drei Einrichtungen aus Ihrer Sicht schildern?
Als die Jüdischen Studien im Wintersemester 1994/95 nur wenige Jahre nach der Universitätsgründung als erste Institution für Jüdische Studien in den neuen Bundesländern gegründet wurden, haben wir sie damals methodisch völlig neu konzipiert. Im Anschluss an die Wissenschaft des Judentums haben wir die Jüdischen Studien von vornherein pluridisziplinär ausgerichtet, sodass neben der jüdischen Religion dort immer auch die mehr als 3000-jährige Geschichte des jüdischen Volkes, die unterschiedlichen jüdischen Kulturen und Literaturen, Philosophie, Künste und jüdische Lebenswelten bis in die Gegenwart erforscht und gelehrt wurden. Auch Zionismus und Israel, die Schoa und der Antisemitismus spielten und spielen eine wichtige Rolle. Wir haben uns dabei eher an das amerikanische Modell der Jewish Studies und an das Modell der Hebräischen Universität in Jerusalem angelehnt. Die Jüdischen Studien in Potsdam sind ein pluridisziplinäres Fach, in dem es neben klassischen Judaisten auch Historiker, Philosophen, Literatur- und Kulturwissenschaftler gibt. Und wo es auch um Alltagsgeschichte, Genderfragen, aktuelle Identitätsdebatten und vieles andere geht.
Welche Folgen hatte das?
Damit waren die Jüdischen Studien anschlussfähig für viele andere Fächer in der Philosophischen Fakultät. Wir haben – nicht vom Rand, sondern aus der Mitte der Fakultät – unsere Lehrveranstaltungen auch in andere Institute exportiert, in die Germanistik, die Geschichte, die Slawistik, die Philosophie und so weiter. Wir wollten uns nicht nur mit jüdischer Religion und Religionsgeschichte beschäftigen, sondern auch mit alltäglichem profanen Judentum in seiner ganzen gelebten Breite und Vielfalt. Das macht die Jüdischen Studien interessant auch für säkulare jüdische und nichtjüdische Studierende, die nicht unbedingt in antike Midraschim eintauchen wollen, sondern sich zum Beispiel für frühe Woody-Allen-Filme interessieren, wo nicht Rabbiner, sondern jüdische Psychoanalytiker die charakteristischen jüdischen Figuren sind.
Aber was hat der pluridisziplinäre Ansatz Rabbinatsstudenten zu bieten?
Nun, moderne Rabbinerinnen und Rabbiner sind heute doch mit genau dieser Diversität des jüdischen Lebens in den Gemeinden und im Alltagsleben konfrontiert. Die jüdische Gemeinschaft ist doch längst keine geschlossene Gesellschaft mehr. Denken Sie allein an die beinahe revolutionären Veränderungen durch die Migration von Jüdinnen und Juden aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland in den Jahren seit 1990. Da brauchen Rabbiner neben den Kernkompetenzen im Bereich der Halacha und des Rituals eine Vielfalt von sozialen, historischen, kulturellen und sogar sprachlichen Kompetenzen. Jedenfalls schien das Potsdamer Modell so überzeugend zu sein, dass 1999 dann das AGK als liberales Rabbinerseminar in Potsdam gegründet wurde. Walter Homolka wandte sich an die Jüdischen Studien mit dem Anliegen, gemeinsam eine akademische Rabbinerausbildung an der Universität zu implementieren. Das erschien uns als eine historische Aufgabe, und daraufhin kam es zu einer Zusammenarbeit, die ja eine Zeit lang sehr erfolgreich funktioniert hat. 2006 wurden erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland liberale Rabbinerinnen und Rabbiner ordiniert – ausgebildet in Potsdam.
Warum wurde dann 2013 zusätzlich die School of Jewish Theology gegründet?
Das ging zurück auf eine Empfehlung des deutschen Wissenschaftsrats von 2010, der eine Übertragung des Modells der christlichen theologischen Fakultäten auf die akademische Ausbildung von Imamen an deutschen Universitäten vorgeschlagen hat. Diese Empfehlung hat Homolka als Chance genutzt, um das Gleiche für das Judentum zu fordern. Er hat mit der Drohung, das Abraham Geiger Kolleg könne nach Erfurt verlegt werden, erwirkt, dass das Land Brandenburg in Potsdam die Einrichtung einer School of Jewish Theology ermöglicht und diese mit Professuren ausgestattet hat. Die School hat quasi Fakultätsstatus, mit eigenem Promotionsrecht und eigenem Berufungsrecht.
Es entstand also ein Konkurrenzverhältnis.
Jüdische Studien und Jüdische Theologie haben sich nach 2013 zunächst gut ergänzt: Studierende, die sich ganz auf die Religion konzentrieren und Rabbinica studieren wollten, wurden in der School of Jewish Theology fündig, während Studierende, auch jüdische Studierende, die sich stärker für jüdische Geschichte, Kultur und Literatur interessierten, bei den Jüdischen Studien heimisch wurden. Außerdem konnten die Studierenden stets auch Kurse im jeweils anderen Institut wählen, das war durchlässig. Im Lauf der Zeit hat Walter Homolka, der sowohl der Rektor des AGK als auch seit 2013 viele Jahre lang der geschäftsführende Direktor der School of Jewish Theology war, jedoch immer mehr Macht an sich gerissen und die School sukzessive auch in der Universität isoliert: Mit anderen Instituten der Fakultät hat er ohnehin nie kooperiert, die School bekam eigene Gebäude und Seminarräume auf dem Campus, die Zusammenarbeit mit den Jüdischen Studien litt zusehends.
Um 2010 hatten die Jüdischen Studien an der Universität Potsdam nach Ihren Angaben 300 Studierende. Wie viele sind es heute?
Jüdische Studien und Jüdische Theologie haben zusammen etwa 160 eingeschriebene Studierende in BA und MA, darüber hinaus mehr als 25 Doktorandinnen und Doktoranden. Damit sind wir aber immer noch der größte Standort für diese Fächer zumindest in Deutschland.
Warum ist die Zahl so stark gesunken?
Das hat mit der Wirtschafts- und Finanzkrise und mit der Euro-Krise zu tun, mit prekären Studentenjobs und teuren Wohnungen. Geschätzt die Hälfte unserer Studierenden müssen nebenbei jobben, um ihr Studium bis zum Abschluss zu finanzieren. Unter diesen Bedingungen studieren viele junge Menschen dann gar nicht mehr. Außerdem erwarten viele 20-Jährige von der Universität heute eine Berufsausbildung für den direkten Berufseinstieg nach dem Studium, die man in den geisteswissenschaftlichen Fächern generell so nicht bekommt, auch nicht in Jüdischen Studien oder Jüdischer Theologie. Wir bieten Bildung, keine Ausbildung. Auch Rabbiner werden ja nur sehr wenige. Und ganz allgemein haben sich in den letzten 30 Jahren aus demografischen Gründen die Jahrgangskohorten halbiert.
Gemeinderabbiner müssen nicht zuletzt soziale Kompetenzen erwerben. Das 2006 gegründete orthodoxe Rabbinerseminar zu Berlin fordert von seinen Studenten auch einen BA-Abschluss in Sozialarbeit. Wäre das für liberale und konservative Rabbiner nicht genauso wichtig?
Viele der Rabbinerstudenten in Potsdam kommen ja schon aus einem Beruf, die brauchen kein zusätzliches Praxis-Studium. Und nach dem Potsdamer Modell der Rabbinerausbildung hospitieren alle Rabbinerstudenten – immer generisches Maskulinum – parallel zum Studium in jüdischen Gemeinden. Das ist »training on the job«, und damit erwerben sie unter Aufsicht von erfahrenen Gemeinderabbinerinnen und -rabbinern auch die nötigen sozialen Kompetenzen.
Der Zentralrat der Juden will mit Walter Homolka aufgrund von Machtmissbrauch in Zukunft nicht mehr zusammenarbeiten. Wie soll es an der Universität und mit dem Rabbinerseminar jetzt weitergehen?
Grundsätzlich bin ich froh, dass der Zentralrat, das Bundesinnenministerium, das Wissenschaftsministerium Brandenburgs und die Universität Potsdam sich trotz der Homolka-Affäre zu Potsdam als Ort einer liberalen und einer konservativen Rabbinerausbildung auch in Zukunft bekannt haben. Sollte – was wir nicht wissen – Homolka tatsächlich im Sommersemester als einfacher Professor an die Universität zurückkehren, wird er keinerlei Machtposition mehr innehaben. Er muss einfach vier Lehrveranstaltungen halten, und die Studierenden werden hingehen oder nicht hingehen. Die praktische Rabbinerausbildung im Abraham Geiger Kolleg und im Zacharias Frankel College muss jetzt völlig neu strukturiert, finanziert und personell anders aufgestellt werden. »Augen zu und durch« geht nicht. Denn der Ruf der Rabbinerausbildung und des Standorts Potsdam insgesamt ist angeschlagen.
Wie wollen Sie aus diesem Loch wieder herauskommen?
Wenn die Universität Potsdam für jüdische wie nichtjüdische junge Leute wieder Strahlkraft gewinnen soll, dann müssen wir die unsinnige Trennung von Jüdischen Studien und Jüdischer Theologie aufgeben und wieder eng zusammenarbeiten. Dann würde die naturgemäß strenge und spezialisierte Rabbinerausbildung für nur wenige Studierende ergänzt durch das viel breitere und buntere Angebot eines pluridisziplinären akademischen Studiums in jüdischer Geschichte und Kultur, Literatur, Musik, Film, wo auch zeitgenössische Diskussionen ihren Platz hätten. Nur mit einem pluridisziplinären Ansatz und der Eröffnung neuer Berufsfelder kann Potsdam wieder zu einem Hub für jüdische und nichtjüdische Studierende mit Ideen und Interesse an zeitgenössischem Judentum werden.
Mit dem Professor für Jüdische Studien und Philosophie und geschäftsführenden Direktor der Jüdischen Studien an der Universität Potsdam sprach Ayala Goldmann.