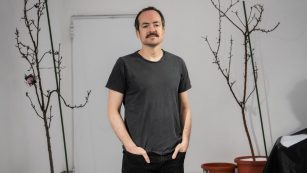Rassismus. Die Erfindung von Menschenrassen lautet der Titel einer am Wochenende eröffneten Sonderausstellung im Dresdner Hygiene-Museum. Der Begleittext der von Susanne Wernsing kuratierten Ausstellung wird dann auch gleich deutlich: »Menschenrassen sind nicht nachzuweisen. Trotzdem ist die Idee in unseren Köpfen«, heißt es. Uns falle es schwer zu sagen, wer »wir« sind. »Lieber beschreiben wir, was uns fremd erscheint.« Sogenannte Rassen seien eine wissenschaftliche Erfindung, die seit dem 18. Jahrhundert ihre unheilvolle Macht entfaltet habe.
Mit diesem »gefährlichen Wort« würden nur scheinbar menschliche Unterschiedlichkeiten beschrieben. In Wahrheit diene es dazu, politische, soziale und kulturelle Ungleichheit zu begründen. Der in Stanford lehrende Historiker Christian Geulen datiert den Beginn rassischer Diskriminierung auf das Jahr 1492, als nach der Vertreibung der Mauren aus Spanien ein religiöses Bekenntnis als Unterscheidungsmerkmal nicht mehr genügte.
unterschiede Der erste Ausstellungsraum befasst sich mit den Versuchen, Rassentheorien dennoch aus biologisch-genetischen Unterschieden abzuleiten. Jüngste entsprechende Äußerungen des Genetikers David Reich von der Harvard University konnte die seit Jahren vorbereitete Ausstellung zwar noch nicht berücksichtigen. Die im beigefügten Essayband vertretene Berliner Politik- und Sozialwissenschaftlerin Naika Foroutan stellt aber klar, dass es sich bei der konstruierten Homogenisierung von Gruppen eher um soziale als um biologische Formierungen handelt.
Ausführlich geht die Ausstellung auf den Rassenwahn der Nationalsozialisten ein. Er gipfelte in der Unterscheidung von angeblich sechs deutschen Rassen, wie ein Plakat zeigt. Dresden, wo es schon kurz nach der Machtergreifung Hitlers 1933 die erste Ausstellung Entartete Kunst gab, spielt eine besondere Rolle. Eine eigene Abteilung thematisiert die Rolle des Deutschen Hygiene-Museums als NS-Propagandamaschine. Die Elbestadt präsentierte 1939 auch die »Kolonialausstellung«.
Der gesamte dritte Raum widmet sich der gleichzeitigen Exotik und Herabwürdigung von »gezähmten Wilden« während der Kolonial-Ära. Die Folgen dieser rassistischen Herrschafts- und Ausbeutungspolitik wirkten bis zu den Fluchtbewegungen unserer Tage nach, hieß es.
ideologien Neben dieser kulturhistorischen Betrachtung des »Rasse«-Begriffs kommen in allen Abteilungen auch solche Persönlichkeiten und Bewegungen zu Wort, die sich kritisch und widerständig mit rassistischen Ideologien auseinandergesetzt haben. Der Berliner Architekt Francis Keré hat jedem der Räume eine eigene Grundstimmung verliehen. Hohe Regale und ein raumfüllendes Gerüst empfangen die Besucher. Karg und monumental ist der Nazi-Raum gehalten.
Besonders einladend wirkt der letzte Raum, eine Raumskulptur aus Pappröhren. Museumsdirektor Klaus Vogel will diese Ausstellung ohnehin nicht als Affront, sondern als ein Plädoyer für Toleranz, Menschenwürde und Diversität verstanden wissen. So lädt der Abschlussraum unter dem Motto »Zusammenleben heute« zu Debatten über rassistisches Verhalten heute ein, das oft den Mantel der Verteidigung eigener Kultur trage. Vier Filmcollagen animieren dazu.
»Rassismus. Die Erfindung von Menschenrassen«. Deutsches Hygiene-Museum Dresden, bis 6. Januar 2019