Unbestritten ist Jesus von Nazareth eine der meistinterpretierten Figuren der Geschichte. Dabei gehen seit jeher nicht nur Historiker ihrer Tätigkeit nach, sondern auch und vor allem Theologen (mindestens) zweier Weltreligionen und Generationen von Rabbinern. Den gewaltigen Bibliotheken der Leben-Jesu-Forschung hat Walter Homolka, Rabbiner und Wissenschaftler, nun ein weiteres Buch hinzugefügt.
Der Titel Der Jude Jesus – Eine Heimholung provoziert zunächst den Gedanken, dass ein solches Unterfangen alles andere als neu ist. David Flusser erforschte das »Neue Testament« schon in den 30er-Jahren vor dessen rabbinisch-pharisäischem Hintergrund. Pinchas Lapide interpretierte etwa zur gleichen Zeit die »Bergpredigt« aus jüdischer Sicht.
Schalom Ben-Chorin erklärte Jesus gar zu seinem »Bruder« und wies ihm als Rabbi einen Platz zu »an der Seite jener, welche die Revolution des Herzens in Israel vollzogen«. Joseph Klausner setzte sich mit einem Buch schließlich zwischen alle Stühle. Seine Position, dass Jesus von Nazareth ein jüdischer Reformer gewesen und als überzeugter Jude gestorben sei, wurde von christlicher und jüdischer Seite gleichermaßen angegriffen.
POLEMIK Die »Heimholung« jenes galiläischen Predigers aus christlicher Vereinnahmung in den jüdisch-halachischen Wertekanon findet auch in letzter Zeit unvermindert statt. Michael J. Cook moniert bei den meisten jüdischen Forschern vor ihm deren problematisches Verhältnis zu Paulus. Jonathan Brumberg-Kraus favorisiert eine säkulare, unvoreingenommene Forschung; Amy-Jill Levine ist der Meinung, dass »die Kehrseite des christlichen Feminismus der Anti-Judaismus« sei – um nur drei der jüngeren jüdischen Wissenschaftler zu nennen.
Führt die »Heimholung« Jesu zu einer besseren Verständigung zwischen Juden und Christen?
Was also würde der kundige Leser in Homolkas Buch an Neuem erfahren? Schon beim Studium des Inhaltsverzeichnisses wird man feststellen, dass auf den folgenden 256 Seiten ein solcher Anspruch offenbar gar nicht verfolgt wird. Vielmehr findet eine gründliche Bestandsaufnahme jener jüdisch-christlichen Auseinandersetzung um Jesus von Nazareth statt. Man erfährt von der Toledot Jeschu, einer jüdischen polemischen Erzählung, die im 8. Jahrhundert in Italien aufkam. Jesus erscheint darin als fehlgeleiteter Schüler der Rabbinen, dem nicht zuletzt seine Zauberkünste zum Verhängnis wurden. Etwa zur selben Zeit entstanden in Spanien und Südfrankreich »jüdische Polemiken, die christliche bzw. christologische Standpunkte auf hohem Niveau zu widerlegen versuchten«.
TALMUD Dabei sollte es nicht bleiben, und Homolka listet eine ganze Reihe antichristlicher Schriften jüdischer Autoren auf, die im Laufe der Jahrhunderte erschienen. So enthielt im 12. Jahrhundert in französisch-jüdischen Gebetbüchern das Aleinu in einem Zusatz scharfe Beschimpfungen von Jesus und Maria.
Zur gleichen Zeit verschärfte die kirchliche Seite ihre antijüdische Polemik. Homolka beschreibt, wie mit dem Aufkommen der Bettelorden im 13. Jahrhundert auch neue Formen der Judenmission entwickelt wurden. In den öffentlichen Streitgesprächen kam auch der Talmud zur Sprache, in dem christliche Kritiker Ketzereien und Verstöße gegen die Heiligkeit Gottes lasen. Das war in jener Zeit durchaus lebensgefährlich. Damals starben selbst christliche Querdenker wie Savonarola oder Giordano Bruno auf dem Scheiterhaufen. Wie sollten aus diesen Streitgesprächen Juden unbeschadet herauskommen?
Hierzulande wurde die Klage gegen sie durch den Franziskaner Berthold von Regensburg oder den Lyriker Konrad von Würzburg befeuert. Man erfährt bei Homolka aber auch, dass es auf jüdischer Seite durchaus Stimmen gab, Christen seien keine Ketzer und deren Jesus-Anbetung kein Götzendienst. Rabbi Menachem Ha-Meiri von Perpignan bescheinigte ihnen gar »eine Lehre von hohem ethischen Standard«.
AUFKLÄRUNG Im 18. Jahrhundert wandte sich Moses Mendelssohn dezidiert gegen den Toledot Jeschu und rückte den toragläubigen Jeshua von Nazareth ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Im Zeitalter der Aufklärung ordnete die aufkommende Wissenschaft des Judentums ihn schließlich als jüdischen »Volkslehrer« ein, und es ist das Verdienst von Abraham Geiger, solches in der Mitte des 19. Jahrhunderts weiter ins Bewusstsein der Forschung gerückt zu haben.
Die Zeit der »Heimholung« hatte begonnen, und sie dauert an. Und dies nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der bildenden Kunst, der sich Walter Homolka ebenfalls widmet. Man erfährt vom Antisemitismusstreit und deren Protagonisten, dem preußischen Historiker Heinrich von Treitschke und dem Berliner Hofprediger Adolf Stoecker, den rassistischen Wegbereitern der Nationalsozialisten. Nach der Schoa ging die katholische Kirche zaghaft auf die jüdische Seite zu, ehe Papst Benedikt XVI. einen theologischen Fallrückzieher vollzog. Auch diesem unheilvollen Phänomen widmet sich der Autor.
KOEXISTENZ Die Frage, die sich dem Rezensenten am Ende der Lektüre stellt, ist die, ob die »Heimholung« Jesu letztlich zu einer besseren Verständigung zwischen Juden und Christen führt oder eher zu einer Verfestigung der unterschiedlichen Positionen. Natürlich spricht einiges dafür, dass aus dem jahrhundertealten Bruderzwist am Ende eine versöhnliche geschwisterliche Koexistenz werden kann.
Bei der Beurteilung des Jesus aber stehen sich nach wie vor zwei antagonistische Positionen gegenüber. Während das Christentum bei Fragen von Jungfrauengeburt, Dreifaltigkeit und Auferstehung von den Toten auf dogmatischen Glaubenspositionen verharren muss, um seine Existenz zu behaupten, kann insbesondere das liberale Judentum aufgrund der Kenntnis der gesellschaftlichen Verhältnisse im antiken Israel weitaus wissenschaftlicher analysieren.
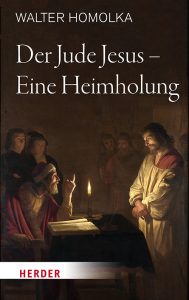
Walter Homolka: »Der Jude Jesus – Eine Heimholung«. Herder, Freiburg 2020, 256 S., 22 €










