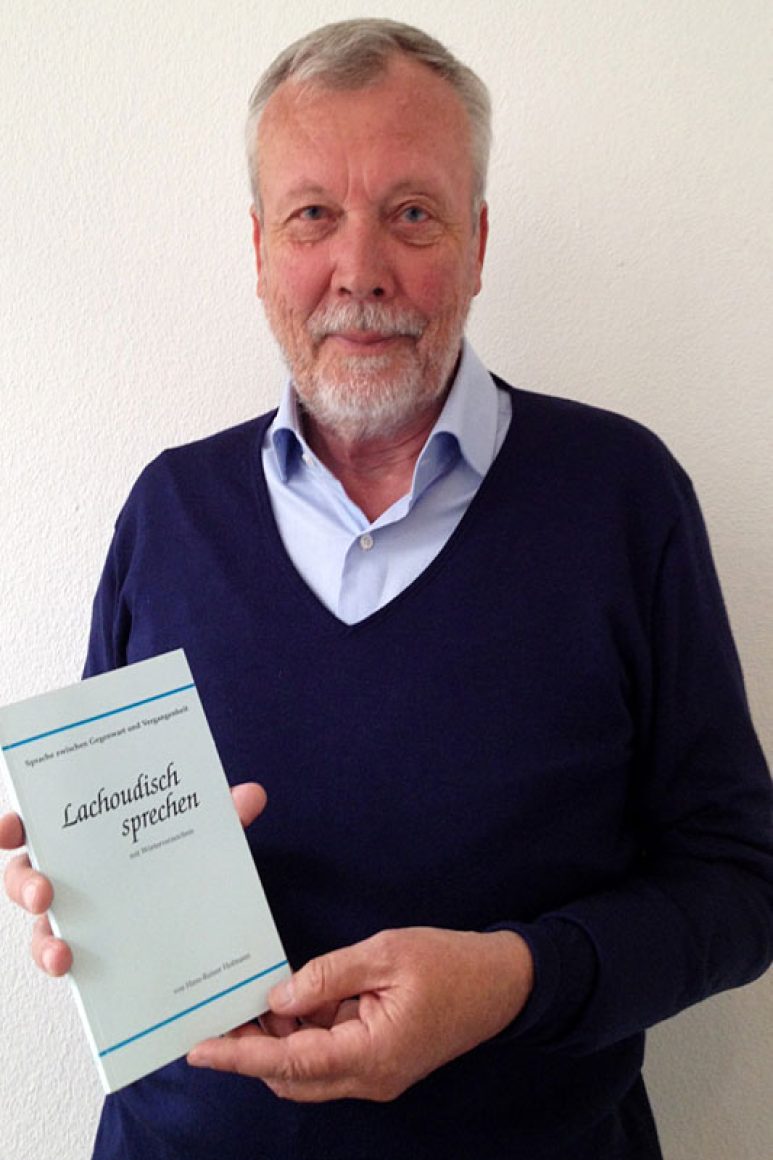Scholem alechem und borech habo, kan in der kal medine», sagt Hans-Rainer Hofmann und übersetzt sogleich: «Grüß Gott und willkommen, hier in der Gemeinde Schopfloch.» Schopfloch ist ein Marktflecken in Mittelfranken, in dem die Bewohner heute noch immer Hebraismen ihrer einstigen jüdischen Nachbarn in der Umgangssprache benutzen. Dass das Phänomen einer größeren Öffentlichkeit bekannt wurde, ist Hans-Rainer Hofmann zu verdanken.
Als der Ansbacher Politiker 1978 Bürgermeister des 3000-Einwohner-Ortes wurde (und es ein Vierteljahrhundert lang blieb), wunderte er sich, dass er kaum etwas verstand, wenn er den Gesprächen der Einheimischen im Wirtshaus lauschte. Heute, als Ruheständler und wieder in Ansbach lebend, ist Hofmann Lachoudisch-Experte. Denn das war es, was die Leute in Schopfloch untereinander sprachen. Lachoudisch (von «leschon hakodesch» – heilige Sprache) ist eine Mischung aus Hebräisch, Rotwelsch und eigenen Wortschöpfungen.
viehhändler Wenn ein Schopflocher sagte: «Am schomamajem nefiches joum halchen ani ins jaroke», dann bedeutete das: «Am Himmelfahrtstag geh ich ins Grüne.» Hofmann begann die Worte und Redewendungen aufzuschreiben, zog von Haus zu Haus, befragte die alten Bauern und ließ sich die deutsche Bedeutung der Begriffe erklären – es sind mehrere Tausend. Nach 20-jährigem Sammeln gab der Hobbysprachforscher ein Wörterbuch heraus, das auf der Arbeit eines früheren Lehrers, Karl Philipp, aufbaut.
Dabei beschäftigte Hofmann sich natürlich auch mit der Geschichte der Schopflocher Juden. 1833 hatte es nachweislich schon 322 Juden im Ort gegeben, 1925 war ein Drittel der damals 1500 Einwohner Juden. Die meisten waren Viehhändler. Juden sind in Schopfloch seit dem 14. Jahrhundert nachweisbar, die jüdische Gemeinde existierte mindestens seit dem 16. Jahrhundert – bis 1938. Damals wurde die Synagoge zerstört. Die meisten Schopflocher Juden konnten noch auswandern – wie Hans Rosenfeld, der mit seiner Familie, die seit Generationen eine Strickerei in Schopfloch besaß, 1937 nach Argentinien floh und der den Ort und den alten jüdischen Friedhof bis heute regelmäßig besucht.
Für das Entstehen der lachoudischen Sprachinsel und für den Erhalt der Sprache über so lange Zeit gibt es verschiedene Gründe, vermutet Hofmann. Zum einen war Schopfloch die einzige Viehhändlersiedlung weit und breit und der einzige Ort in der Nähe, in dem Juden lebten (die außerhalb der Städte wohnen mussten). Ihre christlichen Mittelsmänner, die «Schmuser», die am Schabbat für sie die Geschäfte führten, übernahmen mehr und mehr Begriffe von ihnen und unterhielten sich in diesem Mix auch untereinander, wenn andere nichts verstehen sollten.
Idiom Die meisten (christlichen) Schopflocher waren Maurer und Steinmetze und arbeiteten außerhalb, beispielsweise in Nürnberg. Dort blieben sie unter sich, hielten sich separat von Fremden, saßen auch im Wirtshaus zusammen und sprachen ihr Idiom, das außer ihnen niemand verstand. Zudem sei der Ort früher eine einsame SPD-Hochburg gewesen (hier wurde 1904 der erste SPD-Bürgermeister Bayerns gewählt), habe nicht für Hitler gestimmt und war evangelisch, während die Nachbarorte katholisch waren.
«Da hat man nicht hingeheiratet ...», sagt Hofmann, und so blieben die Schopflocher auch mit der Sprache unter sich. Wenn ein Bewohner des Ortes nach Hause zurückkam, dann in die «Medine», die hier, wie wir es aus dem Hebräischen und Jiddischen kennen, die Bedeutung von Heimat, Gegend, Ort oder Land hat. Wanderte einer nach Amerika aus, ging er im Lachoudischen «uebers Jomm», «übers Meer».
Dass von Juden benutzte Worte über die Kontakte mit Händlern, Metzgern und anderen in den allgemeinen Sprachgebrauch eingingen und weitergegeben wurden, gibt es natürlich auch in anderen ländlichen Gegenden, jedoch kaum irgendwo derart konzentriert wie in Schopfloch. Hier wurde auf Lachoudisch gezählt – olf/echod, bejs, gimel, dolet, jej, fouf, sojn, kess, tess, jus –, die Monate hießen Adar, Kislev, Elulli und so weiter, die Wochentage Joum Alef, Joum Bejs, Joum Gimml et cetera, die Farben sind adom, jarok, kachol, chum, schachor oder zahov.
15o bis 200 lachoudische Wörter sind immer noch in Gebrauch. Bis heute lernen Kinder einzelne Begriffe von ihren Eltern und Großeltern, sagt Hofmann, der mit Unterricht und Vorträgen viel dafür tut, dass es so bleibt. Sogar die örtliche Fastnachtsgesellschaft heißt bis heute «Medine» und hat die Pflege des Lachoudischen in ihren Statuten verankert.
Lachoudisch – Eine kleine Beispielliste
achile, achle = essen
Baleboste = Hausfrau
Duches = Gesäß
Eijze, Mekadesch = Rat
Geschem = Regen
hajoum = heute
Kasche = Problem
Oberkuechem = Besserwisser
Laechem = Brot
Majem = Wasser
Mizwefresser = Überfrommer
Niele, Soff = Ende (soffsoff = endlich)
Ponem = Aussehen, Gesicht
Rojn! = Schau!
Schliach = Bote
uebers Jomm = Amerika
Tarnegoule = Huhn
aus: Hans-Rainer Hofmann: «Lachoudisch sprechen. Sprache zwischen Gegenwart und Vergangenheit». Wenng, Dinkelsbühl 1998, 104 S.