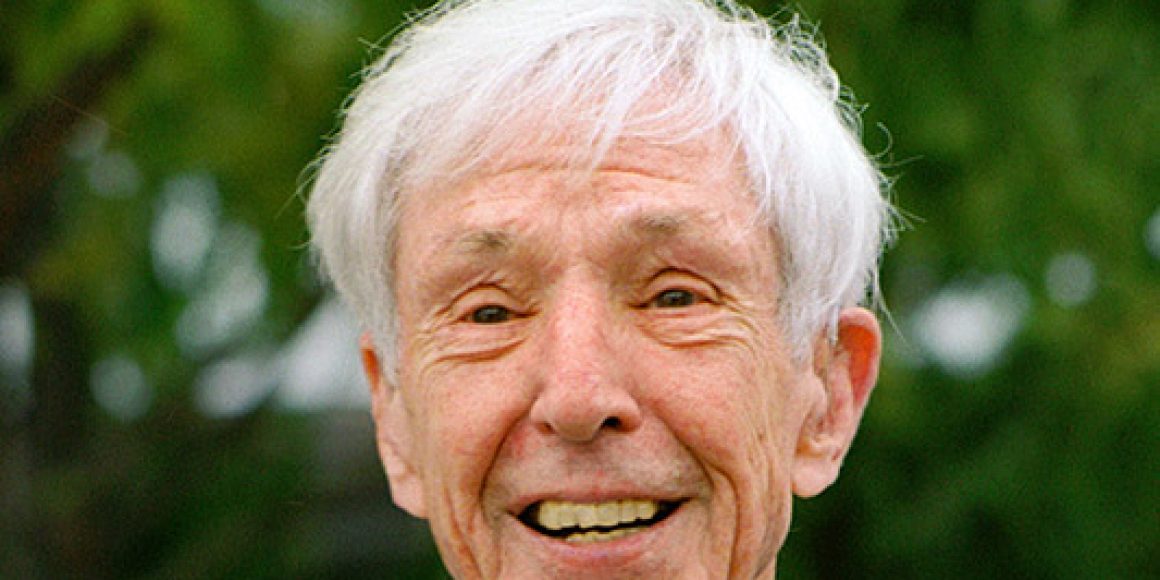Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) hat vor einem Jahr entschieden, dem Pädagogen Hartmut von Hentig den 1998 verliehenen Ernst-Christian-Trapp-Preis (für innovative/unkonventionelle Leistungen in der Erziehungswissenschaft) abzuerkennen. Das ist gut so. Es ging um seine Darstellung der sexuellen Übergriffe an der Odenwaldschule.
Es ist in der Tat bemerkenswert, dass von Hentig 2016 mit der Absicht einer gewissen Relativierung, ja Rechtfertigung der fürchterlichen Ereignisse an der Odenwaldschule ein (weiteres) biografisches Buch herausgab. Es hat den Titel Noch immer Mein Leben: Erinnerungen und Kommentare aus den Jahren 2005 bis 2015. Der Verlag trägt ausgerechnet den Namen »Was mit Kindern« (WAMIKI). So etwas könnte sich vermutlich noch nicht einmal die »Titanic«-Redaktion ausdenken.
Proteste Die DGfE hat sich schon zweimal mit Konflikten über Ehrungen beschäftigen müssen. Der erste Fall betraf 1984 Theodor Wilhelm, der Ehrenvorsitzender dieser Gesellschaft werden sollte. Er hatte unter anderem 1944 öffentlich die Verfolgung insbesondere der ungarischen Juden gefordert. Der zweite Fall betraf Heinrich Roth. 2014 wurde ein Preis der DGfE nach ihm benannt. Roth schrieb 1942, dass es »dem Juden« darum gehe, »seinem Rassetrieb entsprechend« die Psychologie »zur Machtvergrößerung und Geldgewinnung« zu nutzen. Nach Protesten wurde die Namensgebung zurückgezogen. Der dritte Fall aus dieser Generation der Erziehungswissenschaftler ist – zunächst aus ganz anderen Gründen – Hartmut von Hentig.
Es wurde jedoch fast zehn Jahre lang von der Profession übersehen, dass schon Hentigs erste Biografie deutlich macht, um was für eine Person es sich handelt. Der Titel dieser 2007 erschienenen Biografie lautet Mein Leben – bedacht und bejaht. Es ist kaum erklärbar, aber Kernpunkte seiner ersten Biografie zur NS-Zeit wurden in der Profession der Erziehungswissenschaften und der Öffentlichkeit kaum zur Kenntnis genommen oder kritisiert.
Der sich als links verstehende von Hentig entpuppt sich in seiner Biografie als ein so richtiger »deutscher Soldat«, ein »Herrenmensch«, der sich mit Soldatenwitzen über polnische Frauen lustig macht, der ohne Skrupel »die Russen« erschießt und zudem als Erziehungswissenschaftler den Nazi-Reichsarbeitsdienst auch im Jahr 2007 positiv darstellt. Es ist kaum zu glauben, aber alles wird von ihm im Jahr 2007 beschrieben, »bedacht und bejaht«, wie es im Titel versprochen wird.
Chauvinismus Zunächst zum Nazi-Reichsarbeitsdienst (RAD). Hentig schreibt: »Der RAD befreite die Lehrlinge und Hilfsarbeiter von ihren Lehrherren, von streng beaufsichtigter Arbeit und ohnmächtiger Vereinzelung.« Eine pädagogische Meisterleistung! Und dann findet von Hentig sich und seinen Chauvinismus auch noch witzig. Er war nach dem RAD deutscher Soldat: »Am Morgen hatten zwei polnische Frauen meine Stiefel geputzt, Waschwasser aufgestellt, den Rock gebürstet. So lernt man den Feind lieben.« Dieser Landser-Stil war offensichtlich aus von Hentig nicht mehr herauszukriegen.
Ein weiteres Landser-Erlebnis aus seiner Biografie von 2007: Die deutschen Soldaten trotzten der Partisanengefahr, zündeten Dörfer an (»Als wir den Waldrand erreichten, ließ der Schwadronchef halten, zog seine Leuchtpistole und schoss – mit bewundernswerter Treffsicherheit – die Strohdächer der Hütte in Brand.«), was bei Hentig »Unbehagen« erzeugte.
Die deutschen Soldaten raubten zusammen, was irgend ging; von Hentig berichtet weiter: »Bald war mein Schützenpanzerwagen mit dem Schwein beladen und der Schnapskruken so gefüllt, dass die Besatzung nur noch draußen auf den Munitionskästen Platz fand.« Die Partisanen beschossen offensichtlich diese marodierende Truppe, aber das raubt einem von Hentig nicht den Humor: »Einer war verwundet: ein Querschläger im Hintern. Was war das gegen 200 Liter Schnaps!«
Maschinengewehr Er berichtet, wie er »ohne Skrupel« – nochmals: das sind seine Worte – Russen erschoss: »Ich bringe das Maschinengewehr gar nicht mehr zum Deckungsloch zurück, sondern schieße selber in kurzen Feuerstößen direkt auf die Russen, die schon auf fünfzig Meter herangekommen sind und laut zu brüllen beginnen. Ich schieße und sie fallen. Ich habe Menschen getötet – dieses eine Mal in meinem Leben bewusst und ohne Skrupel.«
Wer das ganze Buch liest, weiß, dass von Hentig sich nicht als Nazi sah. Er war eben ein »Herrenmensch« aus gutem Hause, der mitgemacht, -geraubt und -gemordet hat, während er die primitiven Nazis verachtete. Macht es das wirklich besser?